Tempora/Nummer 5/Text
| ←Nr 4 | Tempora Nr. 5 - Juli 1999 |
Nr 6→ |
TEMPORA
Nr. 5
Arbeit
INHALT
4 . . . Die Kreative Sicht
- von Professor Frederick Mayer
8 . . . Man müsse ja...
- Gedicht von Liesel Willems
9 . . . Zeitblende
- - Ferropolis, Stadt aus Eisen
- - Museen der Arbeit
10 . . . Berufliche Bildung für alle
- von Professor Dr. Hermann Schmidt
13 . . . Arbeit - Familie - Ehe
- Erfahrungen eines Ehepaares
16 . . . Workaholics
- Aspekte dazu von Dr. Med. Nosrat Peseschkian
21 . . . Zeitblende
- Schüler aus Vossenack setzen sich für verfolgte Minderheiten ein
22 . . . Arbeit - Arbeitslosigkeit
- ein Interview mit Rita Kleinwegen-Bätz
26 . . . Unbezahlte Arbeit von Elena Afscharian
30 . . . Kinderarbeit von Jens-Uwe Rahe
34 . . . Lesezeit - Kinderarbeit
- Buchbesprechung
36 . . . Neue Arbeit
- von Professor Frithjof Bergmann
44 . . . Leben und Arbeit
- Perspektiven für die Zukunft
46 . . . Zeitenwende für die Arbeit
- von Roland Greis
49 . . . Zitate
50 . . . Ein langer Weg
- Gedicht von Roland Greis
51 . . . Eine neue Ethik der Arbeit
- von Friedo Zölzer
TEMPORA
- Nr. 5 - Juli 1999
Die Globalisierung unseres Planeten erfordert in allen Bereichen ein
gänzlich neues Denken und Handeln. TEMPORA beschäftigt sich auf
dem Hintergrund der Bahá’í—Lehren mit aktuellen Zeitfragen und möchte
durch Gedankenimpulse die Entwicklung zu einer geeinten Welt fördern.
Herausgeber
- Der Nationale Geistige Rat der Bahá’í in
- Deutschland e.V., Eppsteiner Str. 89
- 65719 Hofheim-Langenhain
Redaktion
Elena Afscharian, Roland Greis, Wolfram Enders, Karl Türke jun., Michael Willems
Redaktionsanschrift
- Redaktion TEMPORA
- Eppsteiner Str. 89
- D-65719 Hofheim
- e—Mail: tempora@bahai.de
Layout
Michael Willems
Lithografie
AWI-Design, Krefeld
Druck
Druckservice Reyhani, Darmstadt
Vertrieb und Bestellungen
- Bahá’í—Verlag
- Eppsteiner Str. 89
- D-65719 Hofheim
- Tel. 06192/2 29 21
- Fax 06192/99 29 99
TEMPORA erscheint halbjährlich.
Abonnementpreis für vier Ausgaben
DM 35,- Einzelpreis DM 9,80.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder des Herausgebers wieder. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine
Haftung. Die Redaktion behält sich sinnbewahrende Kürzungen
und Änderungen der Beiträge vor. Die Zeitschrift und alle in
ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
© Bahá’í-Verlag GmbH 1998
ISSN 1433-2078
Gedruckt auf umweltschonendem Papier.
editorial
An der Schwelle eines neuen Zeitalters erhebt sich in nie gekannter Dringlichkeit eine Frage, deren Beantwortung für das zukünftige Schicksal der Menschheit von entscheidender Bedeutung sein wird: Wird es uns gelingen, das in uns angelegte schöpferische Potential zu nutzen und für die Vielzahl von existenzbedrohenden Problemen neue, kreative, zum Teil längst überfällige Lösungen zu finden? Oder werden wir weiterhin von der Übermacht althergebrachter Strukturen und Denkweisen gelähmt und gehindert werden, das zu tun, was zu unser aller Wohl unerlässlich ist?
Das zentrale Problemfeld, dem wir uns in dieser Ausgabe widmen, ist das der Arbeit. Die Arbeit war im Laufe der Geschichte mehrfach grundlegenden Veränderungen und Umstrukturierungsprozessen ausgesetzt. War aber früher der Wandel der Arbeit örtlich begrenzt, in den verschiedenen Gebieten der Erde zeitlich verschoben und auch in seiner Ausprägung unterschiedlich, so stehen wir heute erstmals vor einem global wirksamen, geradezu revolutionären Prozess der Veränderung.
In allen Teilen der Welt werden immer mehr Menschen in seinen Sog hineingerissen und zur Arbeitslosigkeit verurteilt, nicht etwa, weil nicht genügend Arbeit vorhanden wäre, sondern weil die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen, die die Verteilung der Arbeit regeln, sie daran hindern, tätig zu werden und das in ihnen liegende schöpferische Potential zu entfalten.
Aus diesen Gründen verdienen die Anregungen, die Professor Frithjof Bergmann und Professor Frederick Mayer in ihren Artikeln geben, besondere Beachtung. Der Kreativitätsforscher und Pädagoge Professor Mayer lenkt die Aufmerksamkeit auf die zentrale Rolle, die die Entfaltung kreativer Fähigkeiten für die Erfüllung und Sinnfindung des Menschen spielt. Professor Bergmann hat einen Ansatz entwickelt, der sowohl der abnehmenden Menge der herkömmlichen Erwerbsarbeit Rechnung trägt als auch neue Möglichkeiten zur Entfaltung der Kreativität und Eigeninitiative bietet.
Die Kreative Sicht[Bearbeiten]
von Professor Frederick Mayer
Was hat Kreativität eigentlich mit Arbeit zu tun? Eine berechtigte Frage, wenn man das betrachtet, was seit dem Zeitalter der Industrialisierung bis heute unter Arbeit verstanden wird.
Arbeit war und ist überwiegend eine Tätigkeit, die den Menschen sich selbst entfremdet, die ihn zum Anhängsel von Maschinen und zum Opfer übermächtiger, undurchschauter Strukturen und Prozesse macht.
Was im Zeitalter der Globalisierung dazukam, war wachsender Konkurrenzdruck und eine epidemieartig um sich greifende Arbeitslosigkeit. Inzwischen ist der Gesamtorganismus der Arbeitswelt so weit krank, dass die traditionellen Heilmittel keine Wirkung mehr zeigen. Ohne kreative neue Therapiemethoden werden die Krebsgeschwüre einer vom Profitdenken gesteuerten Monopolisierung und Globalisierung den Zerfallsprozess weiter beschleunigen und die kranke Weltwirtschaft ruinieren,
Eine völlig neue Herangehensweise in allen Bereichen des Lebens ist gefragt. Das schöpferische Potential der Menschheit muss wiedererweckt und zur Geltung gebracht werden. Dass dieser Schritt nicht nur notwendig ist, sondern einem tiefen menschlichen Bedürfnis entspricht und den Menschen zu seinem geistigen Selbst führen kann, zeigt der folgende Artikel von Professor Frederick Mayer.
Kreativität verlangt Hingabe weit mehr als theoretische Betrachtungen. Kreativität ist nicht etwas, das wie eine Ware verkauft werden kann, verpackt von Werbefachleuten. Sie brauchen Schlagworte, um die Mittelmäßigkeit ihrer Ware zu verdecken. Auch Neuheit ist nicht identisch mit Kreativität; sie kann lediglich bedeuten, und zwar ist das in unserer Zeit so üblich, dass die Regeln der Mode sich bis auf Moralität, Wirtschaft, Kunst und Erziehung ausdehnen. Der Bestseller, das meistdiskutierte Theaterstück, der bekannte Redner, die berühmte Persönlichkeit - sie alle repräsentieren selten wirkliche Kreativität. Sie sind oft einfach Produkte von Kommunikations- und Publizitätsfertigkeiten.
Es hat in der Geschichte relativ wenige Phasen echter Kreativität gegeben. Das Zeitalter
des Perikles, die Renaissance, die Aufklärung, die Guptazeit in Indien, die Tang-Dynastie
in China - dies sind die Ausnahmen inmitten langer Perioden von Mittelmäßigkeit und kulturellem
Verfall. Ganze Zivilisationen wie die der Assyrer, der Deutschen unter Hitler, widmeten sich
freiwillig der Kriegsführung, die die Barbarei zur Blüte brachte.
Die kreativen Perioden waren Phasen der Rebellion gegen Gedankenkontrolle. Sie glorifizierten die Möglichkeiten und den Glanz des Menschen. Sie verbreiteten Kultur so weit wie möglich. Sie machten Kunst zu einer gelebten Realität, und sie erforschten neue Dimensionen mitmenschlicher Beziehungen. Mehr noch, diese kreativen Phasen entwickelten eine Basis für allgemeines und universelles Verstehen. Sie ermutigten zu beständigem Humanismus. Sie verwarfen jede Form von Dualismus im ethisch-geistigen und im ästhetischen Bereich.
Kurz, zu diesen Zeiten war Erziehung nicht ein enzyklopädisches Unternehmen, sie war kein disziplinärer Prozess, und sie bestand nicht in der Sehnsucht nach überholter Vergangenheit. Sie bestand vielmehr in der Kultivierung dessen, was die meisten als unwesentlich betrachten, sogar als überflüssigen Zierat - nämlich das Potential des menschlichen Geistes.
Andere Zeiten, wie z. B. das frühe Mittelalter, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges sowie die Ära der
puritanischen Dominierung in den Vereinigten Staaten, waren auffallend unkreativ. Sie waren Zeiten
[Seite 5] der Unterdrückung, der akademischen Sterilität, der sozialen Unsicherheit, wo es wenig echte Freizeit
gab und Künstler eine untergeordnete Rolle spielten. Dies waren Perioden erstickender Orthodoxie,
die den Menschen als Sache betrachteten, die man indoktrinieren kann, und für die Erziehung als ein
Unternehmen sekundärer Natur galt. Der kreative Geist war im Laufe der Geschichte immer von
Militarismus bedroht, von Krieg, vom Evangelium der Arbeit, vom Puritanismus und heute von der
Automatisierung des Lebens.
der Unterdrückung, der akademischen Sterilität, der sozialen Unsicherheit, wo es wenig echte Freizeit
gab und Künstler eine untergeordnete Rolle spielten. Dies waren Perioden erstickender Orthodoxie,
die den Menschen als Sache betrachteten, die man indoktrinieren kann, und für die Erziehung als ein
Unternehmen sekundärer Natur galt. Der kreative Geist war im Laufe der Geschichte immer von
Militarismus bedroht, von Krieg, vom Evangelium der Arbeit, vom Puritanismus und heute von der
Automatisierung des Lebens.
Wenn wir den Zustand einer modernen Stadt, sei es Tokio, Moskau, Berlin mit dem antiken Athen vergleichen, so können wir nicht von menschlichem Fortschritt schwärmen. Diese Städte sind Denkmäler der Zweckmäßigkeit; sie sind überfüllt und verschmutzt. Sie sind weder Zeichen für den Schönheitssinn der Menschen noch für sein Bedürfnis nach kreativer Freiheit und existentieller Entfaltung.
Herkömmliche Erziehung ist ein Haupthindernis für die Verwirklichung von Kreativität.
Konventionelle Erziehung setzt wenig Vertrauen in das Schöne als Lebensstil. Sie ist hauptsächlich
daran interessiert, Theorien vom Schönen zu diskutieren und zu kritisieren. Die herkömmliche Schule
mit ihrer farblosen Atmosphäre und eklektischen Architektur ist ein Bild geistiger Depression und
weckt keinerlei Freude im Auge des Betrachters. Konventionelle Erziehung fördert Spezialisierung.
Damit wird aber die Interdependenz aller Kenntnis vernachlässigt, und stattdessen werden belanglose
Interessen geschaffen und unwichtige Aufgaben übermäßig exploriert. Gewiss, der Fortschritt
der Wissenschaften, wie z.B. der Biologie, hängt von Subdisziplinen ab, und wir sollten niemals
Oberflächlichkeit ermutigen, weder in den Natur- noch in den Humanwissenschaften. Aber bleibende
Größe setzt die Perspektive eines Leonardo oder eines Shakespeare, eines Sir Francis Bacon oder
eines Goethe voraus. Der Einwand wird sofort erhoben werden, dass es sich hier um Einzelpersönlichkeiten
handle, Genies, deren es in der Menschheitsgeschichte nur wenige gab, deren Schöpfungen kaum nachgeahmt
werden können, dass es sogar nur wenige gebe, die das volle Ausmaß, die ganze Breite ihrer Interessen
und Anliegen überhaupt erfassen können. - Sind wir dazu verurteilt, lediglich Spezialisten zu sein?
Sind wir dazu verurteilt, nur unwichtige Beiträge zu bringen? Ist unsere Zeit dazu gezwungen, von
einem eklektischen Geist in eine intellektuelle Öde geleitet zu werden, wie es von T.S. Eliot beschrieben
wurde? Die Antwort wird davon abhängen, ob es uns gelingt, unser jetziges System des Übens und
Konditionierens zu überwinden, das gegen die Kreativität Krieg führt, selbst wenn es nach
außen hin ihre Wichtigkeit hervorhebt.
Wir sollten uns daran erinnern, dass die Athener unter Perikles mehr Geld für die Künste als für
Verteidigung ausgaben. Keine moderne Nation kann dies für sich behaupten. In unseren Tagen heißt
Künstler sein oft, einem Hungerdasein ausgesetzt zu sein. In der Renaissance dagegen wurde ein Künstler
oft über Jahrzehnte hin unterhalten, ohne dass man dauernde Produktivität von ihm erwartete. Dichter,
wenn sie nicht die Berühmtheit eines Robert Frost oder eines Lowell erlangen, werden nur von wenigen
gelesen und müssen oft selbst die Drucklegung ihrer Werke finanzieren. In einer Leistungsgesellschaft
werden die Künste als Nebensache betrachtet.
Shelley hob schon das Dilemma des Lebensstils der Nützlichkeit hervor, als er erklärte: „Wir haben mehr ethische, politische und historische Weisheit, als wir in die Praxis umzusetzen wissen; wir haben mehr wissenschaftliche und wirtschaftliche Kenntnisse, als auf eine gerechte Verteilung des Produktes, das sie multiplizieren, angewandt werden können. Wir erwarten von der kreativen Fähigkeit in uns, sich das vorzustellen, was wir wissen; wir erwarten vom Aktionsimpuls, dass er das tut, was wir uns vorstellen, (...) unsere Berechnungen haben die Konzeption überholt, wir haben mehr gegessen, als wir verdauen können.“
[Seite 6] DAS KREATIVE WAGNIS
DAS KREATIVE WAGNIS
Die Suche nach Kreativität beinhaltet nicht nur rationale Analyse, sondern auch Vertrauen zur Intuition, eine dauernde existentielle Offenheit. Ein großer Architekt wie Neutra war derart in seine Kreationen vertieft, dass er alles Zeitgefühl verlor. Ein großer Wissenschaftler wie Norbert Wiener verlor sich manchmal so sehr in seinen Theorien, dass er nicht wußte, wo er war und mit seiner unmittelbaren Umgebung keinen Kontakt mehr hatte. Seine Gedanken und Ideen kamen wie Sturzfluten.
Er war wie besessen von seiner Arbeit.
Für den Durchschnittsmenschen ist Arbeit eine Sache der Routine. Für den kreativen Menschen dagegen bedeutet Arbeit eine dringende Herausforderung, die Ruhelosigkeit verursacht.
Es gibt zwei Hauptarten schöpferischen Verhaltens. Die eine ist methodisch und gegründet auf Analyse. Dies ist die Kreativität des Wissenschaftlers im Labor. Wir finden diese Art auch in einem Philosophen wie Santayana. Als er an der Harvard-Universität Vorlesungen hielt, brachte er Gedanken hervor, die sich zu einem kunstvollen Mosaik zusammenfanden. Sein System war zusammenhängend entwickelt und so geordnet konstruiert wie eine Kathedrale der Renaissance.
Die andere Art der Kreativität ist mehr spontan und emotional. Sie ist im Grund dionysisch (rauschhaft und erfüllt von wilder Begeisterung)
Wir sind von einer Macht überwältigt, die wir zum Ausdruck bringen wollen. Wir sind von einer Kraft und einem Impuls überkommen, die wir nicht kontrollieren können. Wir werden zu einer Brücke für die Kreativität, für die wir selbst ein Beispiel sind. Dieser dionysische Strom, den Nietzsche so eindrucksvoll beschrieben hat, bildet die Basis, auf der viel Kunst beruht und viel menschlicher Fortschritt gedeiht. Solche Kreativität bedeutet Entbehrung. So gab Thoreau das Stadtleben auf, als er nach Walden ging, um der Natur nahe zu sein. Tolstoj gab die Sicherheit seiner aristokratischen Umgebung auf, um den russischen Leibeigenen nahe zu sein.
Solches Wagnis verursacht sowohl Erregung als auch Depression. Ein neuer Weg ist gefunden, eine neue
Beziehung ist aufgenommen, aber der Ausgang des Unternehmens ist unbekannt. Es gibt Augenblicke, wo
der Künstler, wie Tolstoj es versuchte, sein Manuskript zerreissen und seine Arbeit hinwerfen möchte.
Baudelaire sagte: „Ich weiß, dass der Schmerz das einzig Edle ist.“
Leiden ist ein fast unvermeidlicher Teil des Schöpferischen. Es mag nicht offen zutagetreten. Es besteht meist in einem Angriff auf das eigene Werk. Ist es nicht unwichtig? Ist es nicht unbedeutend im Vergleich zu dem, was die Vergangenheit hervorgebracht hat? Ist nicht der Fortschritt quälend langsam? Es gibt Augenblicke, wo Inspiration zu Hilfe kommt. Dann kommt alles in drängender Eile; dann erscheinen Hindernisse gering
Es ist wie eine blitzartige Eingebung, die Tschaikowsky in einzigartiger Weise beschreibt:
„Gewöhnlich erscheint der Kern des zukünftigen Werkes ganz plötzlich und unerwartet. Wenn der Boden günstig ist, wenn ich zur Arbeit aufgelegt bin, wächst dieser Kern mit unglaublicher Schnelligkeit. Er streckt seine Wurzeln aus, dann den Stiel, die Zweige, die Blätter und endlich die Blume. Ich kann nur so den schöpferischen Prozess schildern. Das Wichtigste und Schwierigste ist das Erscheinen des Kerns im günstigen Augenblick. Alles andere kommt von selbst. Ich kann ihnen nicht sagen, wie selig ich bin, wenn der Hauptgedanke sich in mir regt, nach einer gewissen Form strebt und zu wachsen beginnt. Ich vergesse alles, lebe und zittere, finde kaum Zeit, die Skizze zu notieren. Die Gedanken jagen einander.“
Es gibt Zeiten, wo der Künstler sich nicht als getrenntes Individuum fühlt, sondern als Teil seiner Kreation.
So sagt Jung, Goethe habe nicht Faust geschaffen, sondern Faust Goethe.
[Seite 7] Die Arbeit adelt den Künstler. Er mag arm und isoliert sein, doch seine Arbeit gibt ihm einmalige Würde.
Er weiß, dass er sterben wird, dass seine leibliche Hülle vergeht, dass sein Werk jedoch leben wird - ein
Zeugnis menschlicher Kreativität.
Die Arbeit adelt den Künstler. Er mag arm und isoliert sein, doch seine Arbeit gibt ihm einmalige Würde.
Er weiß, dass er sterben wird, dass seine leibliche Hülle vergeht, dass sein Werk jedoch leben wird - ein
Zeugnis menschlicher Kreativität.
Die Augenblicke der Erhebung sind gewöhnlich kurz. Wie Dante, nachdem er die „Göttliche Komödie“ vollendet hatte, kehrt der Künstler in den grauen Alltag mit all seinen Ungewissheiten zurück. Es ist wie Nietzsches „ewige Wiederkehr“; der Prozess der Stagnation der Produktion, Verzweiflung und Freude, Zerrissenheit und Vereinigung, Depression und Euphorie wiederholt sich endlos.
Alles, was statisch ist, muss überwunden werden - ob in der Existenz des Einzelnen oder in der Gesellschaft. Toynbee stellt in dieser Sicht fest: „Zivilisation ist etwas Bewegliches und nicht etwa ein Zustand, eine Pilgerreise, und nicht etwa ein Hafen.“
Konventionelle Erziehung ist ein ewiges Warten auf Erleuchtung, die nie kommt. Es ist wie in Becketts
„Warten auf Godot“. In der Grundschule warten wir auf die Mittelstufe, und dann warten wir auf die
Universität. Dies ist dann nur ein Vorspiel unserer Aktivitäten als Erwachsene. Schließlich sind wir
enttäuscht von unseren aktiven Jahren und warten auf die Muße des Ruhestandes.
Unbegrenzte Freiheit scheint für viele Menschen wie ein utopischer Zustand. Ist es nicht wunderbar, keine geschäftlichen Pflichten mehr zu haben und von der Arbeit befreit zu sein? Doch die Realität ist meistens total anders. Für viele Menschen bedeutet der Ruhestand endlose Langeweile und eine immer größer werdende Unzufriedenheit. Wie wichtig ist es tiefgreifende Interessen zu haben! Wie bedeutend ist es, dass wir uns nicht von falschen Konventionen leiten lassen!
Tolstoj beschreibt im „Tod des Iwan Illich“ einen konventionell erzogenen Menschen. Gewiss, er hatte viele Fakten gelernt, er war ein ausgezeichneter Jurist, und er genoss gesellschaftliches Ansehen, aber er hatte keine lebendigen Beziehungen zu seiner Familie und seinen Freunden. Sein Arzt behandelte ihn wie einen Fall, genau wie jene, die als Bittsteller zu ihm kamen. Seine Tragödie bestand in der Vergeudung, im Vorbeigehen am wahren Leben, er hatte seine Existenz nicht schöpferisch erlebt, sondern nur ertragen.
Wir können Kreativität nicht analysieren. Sie ist wesentlich eine undefinierbare Qualität wie Schönheit, Wahrheit und das Gute. Wenn ihr Geist uns anrührt, so ist unser Leben verändert, gewinnt neue Farbe und Intensität. Wenn wir sie meiden, so begehen wir im übertragenen Sinne geistigen Selbstmord.
Der echte Lehrer ist ein Katalysator, der den Funken in uns
zum Brennen bringt. Durch seine Inspirationen macht er uns
auf unser eigenes Potential - ob in der Arbeit oder in der
Freizeit - aufmerksam. Die Freude am Kreativen übertrifft sinnliche
Freuden. Kreativität bringt Hochstimmung in die Struktur der
Erfahrung selbst, ein Bewusstwerden von Visionen und Träumen,
welche der Alltagsexistenz Farbe und Sinn verleihen.
Thoreau beschrieb diese Stimmung in „Walden“: „Wenn Tag
und Nacht so sind, dass du sie mit Freude begrüßt, und wenn
das Leben einen Duft wie von Blumen und lieblichen Kräutern
ausströmt, wenn es sich ausweitet, voller Sterne und unsterblich
erscheint, - so ist das dein eigener Verdienst. Die ganze Natur
ist zu deiner Gratulation da...“
- PROFESSOR FREDERICK MAYER ist international als Kreativitätsexperte anerkannt, er war Universitätsprofessor in den USA und ist Autor von mehr als 20 Büchern. Er hat die moderne internationale Pädagogik wesentlich beeinflusst
- Sein Buch „History of Educational Thought“ war als Lehrbuch an über 400 Universitäten für Pädagogikstudenten Pflichtlektüre.
- Roland Greis: „Flugversuche“, Japanische Tuschen
- Man müsse ja die meiste Zeit seines Lebens
- auf seiner Arbeitsstelle verbringen.
- Man wolle alles richtig machen.
- Man könne es nicht ertragen, den ganzen Tag
- wie der letzte Mensch behandelt zu werden.
- Man strenge sich deshalb an.
- Man gäbe sich alle Mühe.
- Man gäbe sein Letztes.
- Man wisse ja,
- wie erschöpft man sei, am Abend.
- Man wisse ja,
- dass man sich nur noch verkriechen möchte.
- Schlimm sei dann,
- wenn zu Hause jemand wartet.
- Man hoffe nur,
- dass man in Ruhe gelassen würde.
- Man wisse ja,
- dass es so nicht weitergehen kann.
- Aber was solle man machen, man müsse ja
- von irgendwas leben.
- Liesel Willems, 1997
ZEITBLENDE[Bearbeiten]
Ferropolis, Stadt aus Eisen
Als Anfang der neunziger Jahre das Braunkohlevorkommen in der Tagebaugrube Golpa
Nord, im Städtedreieck Dessau, Bitterfeld und Wittenberg gelegen, erschöpft war, blieben
auf einer ca. 20 ha großen Halbinsel fünf Tagebaugrossgeräte zurück.
Inmitten einer verwundeten Landschaft boten sie ein trauriges Bild.
Nun formen sie sich zu einer gigantischen Stahlskulptur mit Industriemuseum und Veranstaltungsort für mehr als 10.000 Zuschauer.
Ferropolis - die neue Stadt aus Eisen - nach einer Idee des Bauhauses des nahe gelegenen Dessau, liegt am Ortsrand von Gräfenhainichen. Dort wird sie, pünktlich zur EXPO 2000, Mittler zwischen regionaler Geschichte und den Perspektiven einer vom Bergbau gezeichneten Landschaft sein.
Museen der Arbeit
Route der Industriekultur
auf 400 km vorbei an bedeutenden und attraktiven Orten
der Industriekultur, durch eine der dichtesten
Kulturregionen der Welt
- 19 Ankerpunkte
- 6 überregionale Museen
- 9 Industrie-Panoramen
- 24 Themenrouten
- Fon 0180/ 4 00 0086
- Internet: www.route-industriekultur.de
- eMail: info@route-industriekultur.de
Berufliche Bildung für alle[Bearbeiten]
Prof. Dr. Hermann Schmidt, Präsident a.D. Bundesinstitut für Berufsbildung
„Wenn der Wind der Veränderung weht, errichten manche Mauern, andere bauen Windmühlen“
- sagt ein chinesisches Sprichwort. Die Welt um uns scheint nichts Stabiles mehr zu kennen. Alles
verändert sich. Manches so schnell, daß viele von einem Schwindel befallen werden und sich lieber
in ihre Mauern zurückziehen. Viele sind verunsichert durch die vielen neuen Dinge und suchen
Felder, die weniger turbulent sind. Dies ist allerdings nicht die richtige Antwort auf die vielen
Veränderungen in der Technik, der Politik, in Kunst und Wissenschaft, in der Gesellschaft und vor
allen Dingen im Beruf und auf dem Arbeitsmarkt.
„Windmühlen bauen“ heißt, den Wandel für sich selbst nutzbar zu machen. Dazu muss jeder Einzelne, insbesondere aber junge Menschen, Selbstbewusstsein und Sicherheit gewinnen. Dies geschieht am besten durch eine breite berufliche Grundausbildung nach der Schule und vor dem Eintritt in einen Beruf. In den meisten Ländern der Erde gibt es eine systematische Berufsausbildung für eine relativ kleine Zahl von Jugendlichen nur in beruflichen Schulen. Die Mehrzahl der Pflichtschulabsolventen nimmt jedoch - wenn sich die Gelegenheit dafür bietet - irgendeine Beschäftigung auf und versucht, durch Jobwechsel und Spezialisierung in bestimmten Tätigkeiten eine dauerhafte Beschäftigung zu erreichen. Leider bieten viele Gesellschaften ihren jungen Menschen noch nicht einmal das. Sie entlassen sie aus der Schule in die Arbeitslosigkeit, ein Schicksal, das in vielen Fällen Frust, Drogenabhängigkeit und Kriminalität zur Folge hat.
Mit der Globalisierung, die die Nationen und ihre Bürger enger zusammenrücken lässt,
setzt sich erfreulicherweise immer mehr die Auffassung durch, dass nur mit einer beruflich gut
qualifizierten Bevölkerung die Ziele von Frieden und Wohlstand der Völker erreichbar sind.
In den Deutsch sprechenden Ländern hat die berufliche Bildung traditionell einen höheren
gesellschaftlichen Stellenwert als in vielen anderen Ländern. Die schulische Berufsausbildung
hat bei uns, in der Schweiz und Österreich, in den letzten 20 Jahren aber auch in den Niederlanden
und Dänemark einen kräftigen Partner: die betrieblich/schulische Berufsausbildung im sogenannten
DUALEN AUSBILDUNGSSYSTEM. Die Bezeichnung „dual“ macht deutlich, daß während einer je nach Beruf
zwei- bis dreijährigen Ausbildung eine Verbindung von praktischem Lernen im Betrieb (an drei
Wochentagen) mit theoretischem Lernen in der Berufsschule (an zwei Wochentagen) eingegangen wird,
die offenbar den Wünschen vieler Jugendlichen nach aktiv tätigem praxisbezogenen Lernen bei
gleichzeitigem eigenen Einkommen (variiert je nach Beruf : Bäcker
[Seite 11] - ca. DM 700; Versicherungskaufmann - ca. 1250) mehr entgegenkommt als eine weiterführende
Schule
- ca. DM 700; Versicherungskaufmann - ca. 1250) mehr entgegenkommt als eine weiterführende
Schule
Rund 70 % der Schüler eines Altersjahrganges streben nach dem Verlassen der Schule (im
Alter von 16 bis 20) eine Ausbildung im dualen Ausbildungssystem an. Dazu gehören auch rund
ein Drittel aller Abiturienten, die entweder vor einem Hochschulstudium ihre späteren
Berufsaussichten durch einen Berufsabschluss in der Praxis verbessern wollen, über eine
Berufsausbildung, beispielsweise im Handwerk, mit anschließender Meisterausbildung und -prüfung
in die Selbständigkeit streben oder aber schnell in den Beruf mit eigenem Verdienst wollen
und auf Weiterbildung mit späterem beruflichen Aufstieg vertrauen.
Da das Duale Ausbildungssystem keine Eingangsvoraussetzungen kennt, bietet es auch Jugendlichen
ohne Schulabschluss eine Chance, vorausgesetzt, es findet sich ein Betrieb, der einen
entsprechenden Ausbildungsvertrag abschließt. Dies war im letzten Jahr immerhin bei über
vierzigtausend Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verließen oder aus der Sonderschule
kamen, der Fall. Kein anderes Bildungssystem ermöglicht es in der Schule gescheiterten Jugendlichen
in diesem Umfang, durch andere Lernformen und durch praktisches Tun zu beweisen, daß mehr als
nur schlechte Schulnoten in ihnen stecken.
Trotz aller Erfolge hat das duale Ausbildungssystem viele seiner Ziele nicht erreicht: der schwerwiegendste Mangel ist, dass es seit Jahren nicht gelingt, allen Jugendlichen, die einen betrieblichen Ausbildungsplatz suchen, einen solchen auch anzubieten. Sicher reichen in manchen Fällen auch die schulischen Voraussetzungen bei den bewerbenden Schülern nicht dazu aus, die gewünschte Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren. Denn in den letzten zwanzig Jahren sind die Anforderungen in allen Berufen gestiegen. Außerdem hat Deutschland als ein Hochlohnland immer mehr Arbeitsplätze für Ungelernte abgebaut, so dass der Ausweg in gering qualifizierte Beschäftigung immer enger wird. Aber das Hauptproblem liegt doch darin, dass es einige hunderttausend Unternehmen gibt, die anders als die etwa vierhunderttausend Ausbildungsbetriebe keine Plätze anbieten. Bundeskanzler Schröder hat nun angekündigt, in einem Bündnis für Arbeit und Ausbildung gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften und den Kultusministern der Länder rund 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Damit könnte die Ausbildungslücke geschlossen werden, die allerdings nicht nur im Angebot der betrieblichen Ausbildungsplätze besteht. Viele Ausbildungsgänge im Gesundheitsbereich (z.B. Logopäden, Heilhilfsberufe) werden nur in Schulen angeboten, bei denen auch lange Wartelisten bestehen. Hier sind die Länder aufgerufen, ihr Angebot zu erhöhen.
Im vergangenen Jahr sind rund 600.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Rund
1,7 Millionen junge Menschen befinden sich im dualen Ausbildungssystem. Von seiten der Wirtschaft
wurde in den vergangenen Jahren die Aufforderung, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen,
mit der Gegenforderung an die Bundesregierung beantwortet, in neuen Beschäftigungsfeldern neue
Ausbildungsberufe zu entwickeln.
[Seite 12] Dann würden viele junge Unternehmen, die in wachsenden Beschäftigungsfeldern bereits den
Mangel an qualifizierten Mitarbeitern spüren, auch zu einem Mehrangebot an Ausbildung bereit
sein. Die Bundesregierung hat dem Wunsch entsprochen. Im Bundesinstitut für Berufsbildung in
Berlin und Bonn, in dem Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder zusammenarbeiten,
sind in den letzten Jahren mehr als zwanzig neue Berufe entwickelt worden, die in der Wirtschaft
auf eine erfreuliche Resonanz gestoßen sind. Zu diesen neuen Berufen zählen u.a.
Dann würden viele junge Unternehmen, die in wachsenden Beschäftigungsfeldern bereits den
Mangel an qualifizierten Mitarbeitern spüren, auch zu einem Mehrangebot an Ausbildung bereit
sein. Die Bundesregierung hat dem Wunsch entsprochen. Im Bundesinstitut für Berufsbildung in
Berlin und Bonn, in dem Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bund und Länder zusammenarbeiten,
sind in den letzten Jahren mehr als zwanzig neue Berufe entwickelt worden, die in der Wirtschaft
auf eine erfreuliche Resonanz gestoßen sind. Zu diesen neuen Berufen zählen u.a.
- Fachinformatiker
- IT(Informationstechnologie)-System-Elektroniker
- IT-System-Kaufmann
- Informationskaufmann
- Mikrotechnologe
- Mechatroniker (Mechaniker/Elektroniker)
Die informationstechnischen Berufe förderten in besonderer Weise die Ausbildungsbereitschaft der
Wirtschaft. Fast 4.800 neue Ausbildungsverträge wurden nach dem Erlass dieser Berufe durch die
Bundesregierung im Jahre 1997 abgeschlossen. Die Branche sagt für die kommenden Jahre den Abschluß
von weiteren 20.000 Ausbildungsverträgen voraus. Aber auch in den traditionellen
Beschäftigungsbereichen sind neue Berufskonzepte entstanden, so z.B.
- Bauwerksabdichter
- Elektroanlagenmonteur
- Fertigungsmechaniker
- Isolierer
- Naturwerksteinmechaniker
- Fluggeräteelektroniker
- Spielzeughersteller
Es ist durchaus nicht so, daß man zum Erlernen der Berufe in der dualen Ausbildung als
Hauptschulabsolvent keine Chance mehr hätte. Der Eindruck wird zur Zeit erweckt, weil die
Unternehmen unter den Bewerbern auswählen können. Deshalb verbessern viele Hauptschüler ihre
Bewerbungschancen durch den Besuch einer Berufsfachschule vor der Ausbildung im dualen
System. Immerhin sind jedoch etwa ein Drittel aller Ausbildungsverträge mit Hauptschulabsolventen
abgeschlossen worden.
International hat die duale Berufsausbildung einen sehr guten Ruf. Viele Länder senden Experten
nach Deutschland, um das System kennenzulernen. Natürlich läßt sich ein Ausbildungssystem nicht
exportieren. Dazu ist es zu sehr in dem Gesellschaftssystem und seinen Besonderheiten verankert,
aus dem es sich entwickelt hat. So ist beispielsweise nur in wenigen anderen Ländern die Bereitschaft
der Unternehmen entwickelt, sich aktiv an der Berufsausbildung zu beteiligen. Dennoch lassen sich
Prinzipien von Ausbildungssystemen „exportieren“, wenn sie in die bestehenden Bildungssysteme eine
Landes „eingepasst“ werden. So haben Dänemark und die Niederlande in den letzten Jahrzehnten duale
Ausbildungssysteme entwickelt, die dem deutschen ähneln, aber durchaus eigenständig sind.
Die USA haben in den letzten fünf Jahren, gefördert durch Präsident Clinton, der das duale
Ausbildungssystem für einen guten Übergang von der Schule in die Arbeitswelt hält, in 35
Einzelstaaten „School-to-Work“-Programme entwickelt, in denen die Unternehmen mit Schulen und
Colleges gemeinsam Ausbildungsgänge für Jugendliche anbieten. In Australien, in der Türkei,
in China und in Süd-Afrika werden erhebliche Anstrengungen unternommen, duale Ausbildungsformen
zu entwickeln.
Vom Ziel, eine Berufsausbildung für alle zu erreichen, sind wir sicher noch ein Stück
entfernt. Da dieses Ziel eine der Voraussetzungen dafür ist, die Existenz der Menschen, wo
immer sie leben, sicherer zu machen und damit den Frieden und Wohlstand der Nationen zu sichern,
darf der Kreativität der Verantwortlichen bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger
Berufsausbildung keine Grenze gesetzt werden.
Arbeit - Familie - Ehe[Bearbeiten]
Jeder dieser drei Bereiche verlangt höchsten Einsatz, will man erfolgreich darin sein. Doch wie ist es zu schaffen, die manchmal sehr gegensätzlichen Anforderungen so zu vereinen, dass sich für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung ergibt?
TEMPORA sprach mit einem Ehepaar, das diesbezüglich über reichhaltige Erfahrungen verfügt.
Da in diesem Gespräch auch sehr persönliche Dinge zur Sprache kamen, hat das Paar es vorgezogen,
anonym zu bleiben. Die Redaktion respektiert selbstverständlich diesen Wunsch, möchte aber
ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Artikel auf tatsächlichen Erfahrungen beruht und nicht
erfunden ist.
ALLGEMEINES:
Ehefrau: Hochschulabschluss; Mutter, Ehefrau, Familienmanagerin
Ehemann: Hochschulabschluss; Vater, Ehemann, außer Haus berufstätig
Zwei Kinder
DAS EHEPAAR:
In völligem gegenseitigen Einverständnis hat das frisch verheiratete
Ehepaar sich dafür entschieden, Kinder zu bekommen und die Aufgabenschwerpunkte
so zu verteilen, dass die Ehefrau zuständig ist für Kindererziehung und Haushalt,
der Ehemann für die finanzielle Erhaltung der Familie durch Berufstätigkeit außer
Haus. Dabei wollen sich beide trotz dieser Aufteilung gegenseitig unterstützen.
Außerdem ist beiden bewusst, dass jeder auch etwas Freiraum für die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit benötigt.
SITUATION DES EHEMANNES:
Ungefähr zeitgleich mit der Familiengründung kommt auf ihn eine
bis dato ungewohnte, extreme Arbeitsbelastung in der Anfangsphase
des Berufes zu. Der Erwartungsdruck in der Arbeitswelt ist sehr hoch,
es stellt sich die Angst vor Versagen und Entlassung, damit auch
Existenzangst um den Erhalt seiner jungen Familie ein. Eine Absicherung
durch Weiterkommen im Beruf ist nur durch überdurchschnittliche
Leistung und Einsatzbereitschaft möglich. Dies geht zu Lasten der Zeit
mit der Ehefrau und den Kindern sowie der Zeit für sich selbst.
SITUATION DER EHEFRAU:
Die Familiengründung konfrontiert sie ebenso wie ihren Mann mit
unerwartet großen Belastungen. In ihrem Wunsch, eine gute Mutter
zu sein, verlangt sie sich bei dem Versuch, die Bedürfnisse der kleinen
Kinder zu erfüllen, einen nie gekannten, kräftezehrenden Einsatz rund
um die Uhr ab, der ihre bisherigen sozialen Kontakte und Tätigkeiten
verhindert. Da sie durch die für das berufliche Fortkommen ihres
Mannes notwendigen Umzüge auch von der Unterstützung durch
Familie oder Freunde abgeschnitten wird, gerät sie in einen Zustand
ständiger Erschöpfung. Dies geht auf Kosten der Zeit für ihren Mann
ebenso wie der Zeit für sich selbst.
KONFLIKTPOTENTIAL:
Das in vielen Familien auftretende zeitliche Zusammentreffen des
Aufbaus in den drei Bereichen Ehe, Familie und Beruf birgt die große
Gefahr völligen „Ausbrennens“ der Beteiligten in sich. Der kaum zu
erfüllende Anspruch an Erfolg auf allen Ebenen wird sowohl von außen,
von der Gesellschaft, Verwandtschaft und Vorgesetzten als auch von
innen, von ihnen selbst an sie gestellt. Bei beiden Partnern kann sich
daraus ein Dauerzustand der Überforderung und Müdigkeit ergeben,
beim Ehemann ergänzt von einem Gefühl des Zuviel an Kontakten, bei
der Ehefrau von der Empfindung der Isolation, die sich noch steigern
kann, wenn sich ihr Arbeitsplatz Kindererziehung durch das Heranwachsen
derselben von einem 130-Stunden-Job zu einer Teilzeitaufgabe
wandelt.
In der jungen Ehe haben sich oft zur Zeit der Aufbauphase von Familie und Beruf die Mechanismen des Krisenmanagements noch nicht gefestigt, so dass auch die Paarbeziehung unter großen Druck gerät. Unbemerkt kann sich Entfremdung einschleichen, so dass die Gefahr einer „emotionellen Scheidung“ entsteht: Der Mann geht eine Beziehung mit seiner Arbeit ein, die Frau „verbindet“ und „verbündet“ sich mit den Kindern. Durch die große Unterschiedlichkeit ihrer Arbeitsbereiche fällt es den Partnern oft schwer, Verständnis für die jeweilige Situation des anderen aufzubringen. Beide können sich vom anderen „im Stich gelassen“ fühlen. Und meist völlig außer Acht gelassen wird die Tatsache, dass nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern selbst sich noch (ein Leben lang) in ihrer eigenen Entwicklung befinden und Raum für die innere Entfaltung brauchen. Jeder Wohnortwechsel kann die Lage verschärfen, da der Mann ein weiteres Mal mehr Energie zum Einfinden in das neue berufliche Umfeld aufbringen muss und die Frau gezwungen ist, erneut ein soziales Netz zu knüpfen.
LÖSUNGSANSÄTZE:
Ein wesentlicher Ansatz ist, im Alltag das Konfliktpotential nicht
aus dem Bewusstsein zu verlieren. Wenn beiden Partnern klar ist, dass
der Erfolg in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen mit dem Erfolg ihrer
eigenen Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Ehe steht und fällt,
erleichtert ihnen das das Setzen von Prioritäten. Sich täglich bewusst
wenigstens ein paar aufmerksame, intensive Augenblicke für sich selbst
und füreinander zu nehmen, sollte mindestens so selbstverständlich
werden wie das Zähneputzen. Dadurch erhält das Paar die Gelegenheit,
[Seite 15] die notwendige Grundeinstellung der Zusammenarbeit zu entwickeln.
Das Verständnis füreinander, ohne das kein Gedeihen der Familie
möglich ist, kann nur entstehen, wenn den eigenen Bedürfnissen, der
Person des anderen und dem WIR Raum und Zeit gegeben werden. Nur
wer sich selbst versteht, ist in der Lage, dem Partner die eigenen Gefühle
zu erklären; das Verstehen der Wesensart und der momentanen Befindlichkeit
des anderen macht einen gemeinsamen Weg erst gangbar.
Dabei muss auch immer wieder aufs Neue der von den Einzelnen
angestrebte Lebensstil und die daraus erforderlich werdende
gemeinsame Lebensplanung beraten werden. Diesbezügliche Überlegungen
sollten sowohl im Vorhinein als auch begleitend angestellt werden, da
der Fluss des Lebens immer wieder neue Anforderungen stellt. Das
Paar sollte in ständigem Gespräch bleiben.
die notwendige Grundeinstellung der Zusammenarbeit zu entwickeln.
Das Verständnis füreinander, ohne das kein Gedeihen der Familie
möglich ist, kann nur entstehen, wenn den eigenen Bedürfnissen, der
Person des anderen und dem WIR Raum und Zeit gegeben werden. Nur
wer sich selbst versteht, ist in der Lage, dem Partner die eigenen Gefühle
zu erklären; das Verstehen der Wesensart und der momentanen Befindlichkeit
des anderen macht einen gemeinsamen Weg erst gangbar.
Dabei muss auch immer wieder aufs Neue der von den Einzelnen
angestrebte Lebensstil und die daraus erforderlich werdende
gemeinsame Lebensplanung beraten werden. Diesbezügliche Überlegungen
sollten sowohl im Vorhinein als auch begleitend angestellt werden, da
der Fluss des Lebens immer wieder neue Anforderungen stellt. Das
Paar sollte in ständigem Gespräch bleiben.
Wesentlich ist dabei der Aufbau eines gemeinsamen geistigen Fundamentes, das gleichermaßen die Basis einer glücklichen Paarbeziehung wie eines erfüllten Familienlebens ist. Solange sich die Partner nur aufeinander konzentrieren, können immer wieder Pattsituationen entstehen. Richtet sich aber die Konzentration auf ein gemeinsames "höheres" Ziel, wie z.B. eine Religion, trifft man sich in einer zutiefst verbindenden Sphäre. Die daraus erwachsende geistige Kraft hilft bei der Überwindung individueller Unterschiede und Unzulänglichkeiten. Die Voraussetzung für ein Leben in Frieden und Balance ist natürlich, dass der Einzelne dies erst einmal im eigenen Herzen entwickelt. Viele mehr oder weniger gute Ratgeber bieten sich derzeit diesbezüglich an. Doch die meisten befassen sich nur mit Teilbereichen des Lebens, so dass man immer wieder vor ungelösten Fragen steht. Die umfassendste Orientierung für das Leben in seiner Ganzheit findet sich wohl in der Religion. Die aufbauenden Kräfte, die man aus ihr schöpfen kann, lassen sich überall einsetzen, für die gesunde Ehe, die harmonische Familie und eine ausgewogene Einstellung zur Arbeit. In einer Gesellschaft, in der heutzutage der Materialismus lediglich die körperlichen, nicht jedoch die seelischen Bedürfnisse berücksichtigt, fehlt allerdings zumeist die Anleitung für die geistige Ausrichtung auf ein gemeinsames höheres Ziel.
In der heutigen Gesellschaft westlicher Prägung hat die Berufstätigkeit außer Haus ein solches Übermaß an Gewichtung erlangt, dass die Leistung der Familienarbeit und Kindererziehung viel zu gering geachtet wird. Und im Alltagsstress wird in vielen Familien der Arbeit an der Paarbeziehung der Eltern noch viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dass dadurch die Basis der Lebensplanung aller Beteiligten ausgehöhlt wird, wird oft missachtet. Eine Umbewertung ist erforderlich. Wenn das Ziel der Partner in erster Linie in der nie endenden Arbeit an der eigenen und gemeinsamen Vervollkommnung hin zu wahrem Menschsein besteht, wenn also die geistige Ausrichtung auf das gleiche höhere Ziel im Mittelpunkt steht und dadurch die Auseinandersetzung miteinander nicht in Kampf gegeneinander entartet, lassen sich Alltagsschwierigkeiten viel leichter in ihrer Bedeutung einordnen und durch die Kraft und die praktischen Ratschläge, die man aus der geistigen Orientierung ziehen kann, lösen.
- „Das Glück der Menschheit wird Wirklichkeit,
- wenn Mann und Frau zusammenwirken
- und gemeinsam voranschreiten,
- denn jeder ist Ergänzung und Helfer des anderen
- 'Abdu'l-Bahá, in: Frauen, S.22, Bahá’í-Verlag, Hofheim
workaholics[Bearbeiten]
- Definition laut Duden:
- „Jemand, der unter dem
- Zwang steht, ununterbrochen
- arbeiten zu müssen.“
Woher kommt dieses zwanghafte Verhalten und wie kann man ihm begegnen?
Dr. med. Nossrat Peseschkian, Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Gründer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychotherapie und Dozent an der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen, hat der TEMPORA-Redaktion für diesen Artikel eine Zusammenfassung wesentlicher Aspekte zu diesem Thema zur Verfügung gestellt.
Unser Leben wird von vier Hauptbereichen bestimmt, nach Dr. Peseschkian die „Qualitäten des Lebens“.
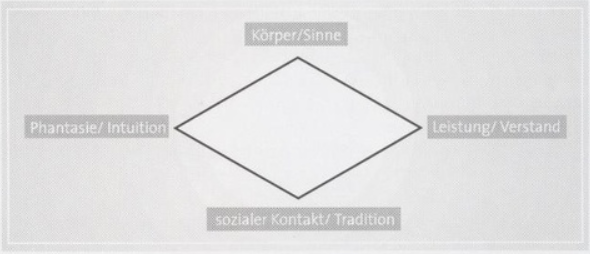
Ein gesunder Mensch, der 100% an Kraft und Aufmerksamkeit zu vergeben hat, investiert in jeden dieser Bereiche ca. 25%, nach Neigung etwas unterschiedlich gewichtet.
Bildlich ausgedrückt entsprechen die vier Bereiche einem Reiter, der
motiviert (Leistung) einem Ziel zustrebt (Phantasie). Er braucht dazu ein
gutes und gepflegtes Pferd (Körper) und für den Fall, daß dieses ihn einmal
abwerfen sollte, Helfer, die ihn beim Aufsteigen unterstützen (Kontakt).
Die einzelnen Lebensqualitäten sind wie folgt charakterisiert:
Körper/Sinne
Im Vordergrund steht das Körper-Ich-Gefühl. Wie nimmt man seinen Körper wahr? Wie erlebt man die verschiedenen Sinneseindrücke aus der Umwelt?
STRESSFAKTOREN: z.B. Krankheiten, bei sich selbst oder Angehörigen, übermäßige akustische oder optische Reize etc.
Leistung/Verstand
Diese Dimension hat in der Industriegesellschaft, vor allem im amerikanisch-europäischen Kulturkreis, ein besonderes Gewicht. Hierzu gehören die Art und Weise, wie Leistungsnormen ausgeprägt sind und wie sie in das Selbstkonzept eingegliedert werden. Denken und Verstand ermöglichen es, systematisch und gezielt Probleme zu lösen und Leistung zu optimieren. Zwei einander entgegengesetzte Konfliktreaktionen sind möglich: die Flucht in die Arbeit und die Flucht vor Leistungsanforderungen.
STRESSFAKTOREN: z.B. Unzufriedenheit mit beruflichen Ergebnissen, Kündigung, Berentung, Höhergruppierung, Nichtbeförderung, Stellenwechsel, neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und/oder Vorgesetzte, Verlust von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern etc
Kontakt/Tradition
Die sozialen Verhaltensweisen werden durch individuelle Lernerfahrungen und die Überlieferung (Tradition) mitgeprägt. Man erwartet von einem Partner zum Beispiel Höflichkeit und Gerechtigkeit und sucht sich schließlich den entsprechenden aus.
Wir können auch auf Konflikte reagieren, indem wir die Beziehung zu unserer Umwelt problematisieren: Ein Extrem ist hierbei die Flucht in die Geselligkeit, wobei in der Geborgenheit und der Aktivität der Gruppe die Probleme entschärft werden sollen. Man versucht durch Gespräche mit anderen, Sympathie zu erwecken und Solidarität zu erzielen: „Wenn ich mich über meine Schwiegermutter aufrege, rufe ich meistens eine Freundin an und spreche mit ihr stundenlang darüber.“ Umgekehrt kann man den Rückzug aus der Gemeinschaft antreten. Man distanziert sich von Menschen, die einen beunruhigen, fühlt sich gehemmt, meidet Geselligkeiten sowie jede Möglichkeit, mit anderen Menschen zusammenzukommen.
STRESSFAKTOREN: z.B. Eingehen einer Partnerschaft, Geburt, Trennung, Hausbau, finanzielle Probleme, zwischenmenschliche Konflikte etc.
Phantasie/Intuition
Die Intuition scheint im Zusammenhang mit den psychischen Prozessen des Traumes oder der Phantasie zu stehen, die gleichfalls eine Form der Problem- und Konfliktverarbeitung darstellen können. Intuition und Phantasie reichen über die unmittelbare Wirklichkeit hinaus und können all das beinhalten, was wir als Sinn einer Tätigkeit, Sinn des Lebens, Wunsch, Zukunftsmalerei oder Utopie bezeichnen. Auf die Fähigkeiten der Intuition und Phantasie und die sich durch sie entwickelnden Bedürfnisse gehen Weltanschauungen und Religionen ein, die damit die Beziehung auch zu einer ferneren Zukunft (Tod, Leben nach dem Tode) vermitteln.
STRESSFAKTOREN: z.B. Todesfälle, Verluste, Selbstzweifel, Schwinden beruflicher oder privater Zukunftsperspektiven, Berentung, Alter etc.
Kommt es zu einer extremen Überbetonung eines dieser Aspekte, führt das zu krankhaften Zuständen. Ein Workaholic konzentriert seine ganze Energie auf den Punkt LEISTUNG. Die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein.
Wie ein Mensch mit Belastungen fertig wird, hängt von seiner Persönlichkeit
und seinen Einstellungen ab. Vor ihrem Hintergrund erhalten die äußeren
Ereignisse ihr emotionales Gewicht.
Der Bereich „Leistung und Verstand“ hat in einer Industriegesellschaft ein besonderes Gewicht. Von der Erziehung eines Menschen ist es abhängig, wie die Leistungsnormen ausgeprägt sind und in das Selbstkonzept des Heranwachsenden eingegliedert werden können. Dabei sind nicht nur die Erziehungsvorstellungen der Eltern wichtig, sondern auch die Normen und Konzepte, die in der jeweiligen Gesellschaft und Kultur vorherrschen. Gerade die Nachkriegsgeneration in Deutschland fand im Leistungsbereich ihre Lebensziele. Überleben und Wiederaufbau prägten anfangs die Denkweise; 50 Jahre Frieden und stetiger Wirtschaftsaufschwung verfestigten die Einstellungen „Kannst du was, dann bist du was!“. Ein Mensch, der gelernt hat, dass er nur dann etwas wert ist, wenn er etwas leistet und berufliche und menschliche Erfolge hat, wird plötzlich eine tiefgreifende Niederlage erleiden, wenn er auf einmal den ihm gestellten Aufgaben nicht mehr gewachsen ist.
Bestimmte Lebensereignisse, z.B. berufliche Veränderungen, Umzug, Todesfall etc. gelten weithin als besonders belastend. Weniger bekannt ist, daß auch viele Kleinigkeiten, wie z. B. Unpünktlichkeit des Partners, Zugverspätung, Unzuverlässigkeit und Ungerechtigkeit des Partners oder eines Mitarbeiters, zu Verletzungen (Mikrotraumen) führen und krank machen können.
Individuell können die einzelnen Stressfaktoren natürlich sehr unterschiedlich stark empfunden werden. Doch ein Leben ohne Stress ist in den Industrienationen kaum vorstellbar. Dies gilt gleichermaßen für den privaten wie auch für den geschäftlichen Bereich. Der Tod des Partners ist, wie Befragungen ergeben haben, der größte Stressfaktor. Als sehr starker Stress wird von den Befragten auch eine Scheidung empfunden. Auf den nächsten Plätzen folgen Stressfaktoren am Arbeitsplatz, nämlich Kündigung, neue Verantwortung und vergeblich erwarteter Aufstieg. Umzug und Urlaub schließen die Liste der wichtigsten Stressoren.
Ist der Mensch durch seine Erziehung stark am Leistungsbereich orientiert, setzt sein Verhalten bei Konflikten dort an.
Zwei einander entgegengesetzte Konfliktsituationen sind möglich, die
Ausdruck einer aktiven bzw. passiven Bewältigungsstrategie sind.
Aktive Dimension:
Flucht in die Leistung, Stressreaktionen, Leistungszwang, Konkurrenzkampf,
Ellenbogenmentalität.
Passive Dimension:
Flucht vor Leistungsanforderungen, Leistungshemmung, Kraft- und Lustlosigkeit,
Zivilisationsmüdigkeit, Apathie, Interesselosigkeit, Konzentrationsmangel.
Konsequenzen aus aktiver und passiver Dimension:
Konzentrationsstörungen, Versagensängste, Hemmungen, Selbstwertprobleme,
Ängste, Aggressionen und Depressionen.
Der Workaholic lässt sein gesamtes Leben von der aktiven Dimension des Leistungsbereiches, vom Leistungszwang beherrschen. Dabei ist er sich der Problematik seines Verhaltens oft nicht bewusst.
„Im Stress sein“ galt lange Zeit als Synonym für bedeutend sein. Stress
wurde mit Leistung gleichgesetzt. Daß der 80-Wochenstunden-Workaholic
womöglich seine persönliche Leistungsgrenze längst überschritten hat,
ist in den wenigsten Fällen klar.
Stress für sich gesehen, ist zunächst einmal etwas Positives. Wissenschaftler unterscheiden zwischen Eustress und Distress. Eustress, positiver kurzzeitiger Stress, ist eine natürliche Verteidigungsstrategie unseres Körpers. Der kanadische Mediziner Hans Selye führte in den dreißiger Jahren erstmals den Begriff Stress in die Psychologie ein und dokumentierte gerade die physischen Veränderungen. Auf eine außergewöhnliche Herausforderung reagiert der Organismus mit einem wohldosierten Hormoncocktail. Dieser stärkt das Immunsystem und spornt zu Höchstleistungen an. Hält dieser Zustand jedoch zulange an, schlägt der positive Effekt ins Negative um. Das innere Gleichgewicht gerät aus den Fugen, Distress entsteht.
Motivationskraft und Leistungsfähigkeit gehen herunter, Libido und Genussfähigkeit werden beeinträchtigt.
Nach Einschätzung von Experten sind rund 75 % aller medizinischen Beschwerden direkt oder indirekt auf Stress zurückzuführen. Die volkswirtschaftlichen Kosten für stressbedingte Erkrankungen belaufen sich in Deutschland auf rund 60 Milliarden Mark pro Jahr.
Ist der krankhafte Charakter des Leistungszwangs bei einem Menschen einmal erkannt, kann zur Heilung folgender Weg eingeschlagen werden:
Hier sind drei Schritte zu berücksichtigen:
1. Worüber ärgere ich mich eigentlich? Was bereitet mir Angst, Unbehagen oder Freude?
2. Welche Möglichkeiten habe ich, das Problem zu lösen?
3. Welche Ziele stehen hinter meinem Handeln? Was würde ich machen, wenn ich keine Probleme und Beschwerden hätte?
Ganz praktisch kann man dazu drei Punkte aufschreiben:
1. Situation: Was liegt vor?
2 IST-Wert: Wie habe ich reagiert?
3 SOLL-Wert: Wie kann ich besser reagieren?
Das Aufschreiben hat den Sinn, Abstand zu gewinnen und eine etwas objektivere Betrachtung zu ermöglichen. Außerdem lassen sich so bei regelmäßiger Anwendung eigene Fortschritte erkennen, eine heilungsfördernde Selbstermutigung.
Bei der Erarbeitung des SOLL-WERTES hilft vor allem die Einordnung der eigenen Situation in die oben beschriebenen vier Qualitäten des Lebens. Wieviel Zeit und Energie widme ich den einzelnen Aspekten? Dabei ist es
[Seite 20] eher hinderlich, sich auf den Abbau der Leistungsorientierung zu konzentrieren. Ein „ich soll nicht...“ wirkt lähmend, motivierend ist dagegen „ich darf...“ Indem man die Bereiche Körper/Sinne, Phantasie/Intuition und sozialer Kontakt/Tradition stärkt, d.h. ihnen in wesentlich ausgewogenerer Weise als zuvor Aufmerksamkeit schenkt, reduziert sich der Einsatz für den Bereich Leistung/Verstand von selbst.
eher hinderlich, sich auf den Abbau der Leistungsorientierung zu konzentrieren. Ein „ich soll nicht...“ wirkt lähmend, motivierend ist dagegen „ich darf...“ Indem man die Bereiche Körper/Sinne, Phantasie/Intuition und sozialer Kontakt/Tradition stärkt, d.h. ihnen in wesentlich ausgewogenerer Weise als zuvor Aufmerksamkeit schenkt, reduziert sich der Einsatz für den Bereich Leistung/Verstand von selbst.
Was der Workaholic also braucht, ist die Erkenntnis seines Zustandes und eine Neubewertung seiner gesamten Lebensumstände. Gute Entwicklungschancen bestehen, wenn er seinen Heilungsprozess ebenfalls dieser Neubewertung unterwirft, d.h. wenn er sich bei der Stärkung der drei bisher eher unterentwickelten Lebensqualitäten nicht in der gewohnten Weise unter Druck setzt.
Geduld, vor allem mit sich selbst, ist gefragt!
Bearbeitung: TEMPORA
ZEITBLENDE[Bearbeiten]
Schüler setzen sich für verfolgte Minderheit ein[Bearbeiten]
Interview mit Schülern der Klassen 10a und 10c des Franziskus-Gymnasiums Vossenack, Kreis Düren
TEMPORA: Ihre Klassen haben sich für die verfolgten Bahá’í im Iran
eingesetzt. Wie ist es dazu gekommen?
SCHÜLERIN: Im Religionsunterricht hatten wir das Thema „Judenverfolgung im Dritten Reich“ durchgenommen. Danach hat unser Religionslehrer, Herr Kummer, uns darauf aufmerksam gemacht, dass es auch heute noch religiöse Verfolgung gibt. Als Beispiel nannte er die Bahá’í. Darüber habe ich dann gemeinsam mit einem Mitschüler ein Referat gehalten.
TEMPORA: Welche Informationsquellen haben Sie für das Referat genutzt?
SCHÜLER: Das Internet.
SCHÜLER DER PARALLELKLASSE: Bei uns war es so: Zunächst haben wir eine Stunde darüber gesprochen, um mehr Hintergrundwissen zu bekommen. Dann haben wir eine Bahá’í eingeladen, um aus erster Hand zu hören, worum es geht.
SCHÜLER: Ja, wir auch.
TEMPORA: Wie haben diese Informationen auf Sie gewirkt?
SCHÜLERIN: Das ist so ähnlich wie bei den Juden gewesen und deshalb denke ich, dass das ein wichtiges Thema ist. Da mussten wir doch aktiv werden, damit nicht wieder das Gleiche passiert, ist doch klar!
SCHÜLER: Ja, das ist doch selbstverständlich, dass man sich für Menschen einsetzt, denen es nicht so gut geht wie uns!
SCHÜLER: Wir haben Postkarten geschrieben, fast jeder von uns. Dazu hatten wir uns einen Text ausgedacht: „I protest against the fact that people who belong to the Bahá’í-religion are arrested and killed for their religious believes, just the same as it is done in the Iran.“ Die haben wir an den Generaldirektor der UNESCO, Frederico Mayor, geschickt.
Außerdem hat unser Internet-Freak die Klasse als Unterzeichner unter den Offenen Brief (www.bahai.de/offenerbrief) gesetzt.
SCHÜLERIN DER PARALLELKLASSE: Wir haben Postkarten auf Französisch geschrieben und einzeln in Abständen abgeschickt, damit da nicht einfach ein Berg Karten auf einmal kommt sondern immer wieder welche.
TEMPORA: Hat diese Aktion bei Ihnen persönlich etwas bewirkt?
SCHÜLERIN: Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber ich habe auch eine andere Religion und vielleicht deshalb eine andere Einstellung dazu. Ich bin jüdisch und kann mich sehr verbunden fühlen mit den Verfolgten.
SCHÜLERIN: Ich würde sagen, die Vorurteile gegenüber Randgruppen sind zurückgegangen. Man denkt jetzt schon mehr darüber nach, wie man sich einem Menschen gegenüber verhält, auch wenn der eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion, was man zu dem sagt und wie man zu dem ist.
Interview[Bearbeiten]
mit Rita Kleinwegen-Bätz
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin
- Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in der Region Eifel in Trägerschaft des Bistums Aachen
Frau Kleinwegen-Bätz, unser Thema lautet ARBEIT - ARBEITSLOSIGKEIT, Auswirkungen auf die
Familie. Stellen Sie in der Beratung einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und familiären
Problemen fest?
- Es gibt sicherlich einen Einfluss. Wobei mit der Arbeitslosigkeit nicht nur ein Wegfall von Arbeit oder finanziellen Ressourcen gegeben ist, sondern auch eine Beeinträchtigung des Selbstbildes. Das geht oft einher mit einem Verschämtsein. Dass Arbeitslose von sich aus zu uns in die Beratung kommen, ist kaum der Fall, eher betroffene Familienangehörige.
Was steht für die betroffenen Familienangehörigen im Vordergrund?
- Im Vordergrund steht, dass die Identität des Einzelnen mit seiner Arbeitsfähigkeit gekoppelt ist. Mit dem Arbeitsplatzverlust ist ganz eng ein Selbstwertverlust verbunden. Wenn einer innerhalb der Beziehung einen Verlust des Selbstwertgefühls erleidet, d.h. wenn er sich nicht mehr als stark, gebraucht, für die Familie nötig empfindet, ist das immer ein Einbruch und hat Auswirkungen. Die gleiche Situation liegt z.B. vor, wenn große Kinder aus dem Haus gehen und der Frau damit ihr gewohntes Arbeitsgebiet entzogen wird.
Wie wirkt sich dieser Selbstwertverlust auf die Angehörigen aus?
- Arbeitslosigkeit hat oft eine Umstrukturierung in der Familie zur Folge, d.h. der Arbeitslose ist zu Hause, ein anderes Familienmitglied findet womöglich eine Stelle und verlässt nun das Haus, so dass völlig neue Aufgabenverteilungen entstehen, in die sich die Betroffenen erst einfinden müssen. Im ländlichen Raum ist es noch häufig so, dass der Mann der Hauptarbeitnehmer ist. Wenn dann bei Arbeitslosigkeit des Mannes die Frau eine Arbeit aufnimmt, ist diese oft weniger qualifiziert. So sind das häufig Arbeitsverhältnisse auf 630,- DM-Basis. Gleichzeitig sind damit Rollenkonflikte verbunden, wenn der Mann zu Hause bleibt und die Frau das Geld verdient. Es ist nicht so, dass Männer selbstverständlich Kinderbetreuung und Haushaltsversorgung übernehmen, Tätigkeiten, die für einen Mann heutzutage noch nicht allgemein anerkannt sind, sein soziales Ansehen also nicht in dem Maße festigen, wie seine Berufstätigkeit vorher. In der Realität übernehmen die Männer vielleicht gerade noch die Kinderbetreuung, einen Ersatz für die Haushaltsarbeit der Frau bieten sie jedoch nicht. Das bringt die Frau in die Situation der Doppelbelastung. Gleichzeitig erfährt die dann ausgeübte Erwerbsarbeit der Frau in den beschriebenen Tätigkeiten ebenfalls keine hohe Wertschätzung. Also bewirkt dieser Wechsel im sozialpsychologischen Bereich eher eine Verschlechterung und wird nicht als gute Lösung empfunden.
D.h. man kann sagen, dass Arbeitslosigkeit auch eine unmittelbare Wirkung auf das Verhältnis der Geschlechter in der Familie hat?
- Ja, da bin ich ganz sicher.
[Seite 23] Gewinnen die Frauen durch eine solche Situation an Selbstbewusstsein?
Gewinnen die Frauen durch eine solche Situation an Selbstbewusstsein?
- Sofern traditionelle Rollenvorstellungen vorherrschen, wonach der Mann für die Außenbeziehungen, für die Arbeit und das Geldverdienen zuständig ist, die Frau dagegen für die Innenbeziehungen innerhalb der Familie, des Haushaltes und der Kindererziehung, trifft das wohl nicht zu. Außerdem ist zumindest in der mittleren und älteren Generation - aufgrund der Ausbildungssituation ein gleichwertiger Tausch der Erwerbsrollen nicht ohne weiteres möglich, da Frauen meist weniger Geld verdienen. Früher haben auf dem Land die meisten Mädchen die Hauptschule besucht, weil es den Familien nicht einsichtig war, in eine Frau zu investieren, die nach der jungen Heirat sowieso Haus und Hof zu versorgen hatte.
- Heutzutage jedoch hat der Strukturwandel auch Regionen erreicht, die viel entlegener sind als die Eifel. So belegen die Schülerinnenzahlen an Realschulen und Gymnasien die zunehmende Qualifizierung der Mädchen. So gut wie alle Mädchen erhalten heute eine gute Ausbildung in Lehre oder Studium. Dadurch erscheint den jungen Frauen selbst, aber oft auch schon den Familien insgesamt, eine Reduktion auf Haushalt und Kinder nicht mehr plausibel, es sei denn, für einen begrenzten überschaubaren Zeitraum, für eine Phase der Kindererziehung entscheiden sich junge Frauen dafür zu Hause zu bleiben. Es ist sicherlich gut, wenn den kleinen Kindern viel Zeit von einem Elternteil gewidmet wird, z.B. von der Mutter; es könnte auch der Vater sein, was aber in unserem ländlichen Raum noch die große Ausnahme ist. Dabei wird der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase von den Frauen in vielen Fällen angestrebt.
- Das hat Vorteile für den Fall, dass der Haupterwerbstätige arbeitslos wird. Es hat aber auch Auswirkungen auf den Individualisierungsprozess mit dem Ergebnis, dass die Frau gegenüber dem Mann in der Familie eine selbständige, unabhängige Position erlangt. Das macht sich sofort bemerkbar, wenn es um Trennung und Scheidung geht. Solange Frauen finanziell von ihrem Mann abhängig sind, werden sie sich gründlich überlegen, ob sie es sich leisten können, sich zu trennen. Wenn sie jedoch wissen, dass sie selbst eine gute Position innehaben und mit ihrem Verdienst und dem Kindesunterhalt des Mannes gut leben können, wird der Schritt in die Trennung im gegebenen Fall wahrscheinlicher.
- Was ich jedoch fast noch öfter beobachte ist, dass die heutige Arbeitsmarktsituation großen Einfluss auf die noch in Arbeit stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat und damit rückwirkend auf die Familien. Die Erwartungen an die Berufstätigen in Bezug auf Flexibilität, Überstunden und weitere Qualifizierung sind sehr hoch. Durch die Rationalisierungsprozesse hat nicht eigentlich die Menge an Arbeit abgenommen, sie ist komplexer geworden und verteilt sich auf weniger Schultern. Die Leute stehen unter sehr großem Druck!
Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Heißt das, in Ihrer Beratungstätigkeit haben Sie noch mehr mit den Auswirkungen der Arbeitsrealität als mit Arbeitslosigkeit zu tun?
- Ja. Es kommt oft vor, dass der Mann sehr wohl eine Stelle hat, oft sogar eine recht gute Position, aber dann für seine Firma "sein letztes Hemd" geben muss. D.h. es gibt keine klaren Absprachen, wann der Mann nach Hause kommt, denn es kann immer vorkommen, dass um 16.00 Uhr noch ein Projekt begonnen werden muss, was zu einer Arbeitssituation ähnlich der von Selbständigen führt. Es werden auch Leistungen gefordert, für die sie nicht ausgebildet wurden und die sie sich dann in kürzester Zeit aneignen müssen.
- Ich erinnere mich z.B. an einen Fall, in dem die Frau sagte, mein Mann spaltet immer mehr Gefühle ab, der kann gar nichts mehr an sich herankommen lassen.
- In dem Moment brach der Mann in Tränen aus und sagte, dass er es sich zur Zeit nicht leisten könne, irgendwelche Gefühle von Zuneigung zu zeigen, weil ihn das aus seiner inneren Spannung herausbringe, die er brauche, um seine letzte Arbeitskraft „herauszupressen“. Er habe sonst das Gefühl, er werde seiner Arbeit nicht gerecht.
- Oder nehmen wir die nicht seltene Situation, dass Werke geschlossen oder von anderen Firmen übernommen werden und die Familie weit weg ziehen müsste. Die moderne Arbeitsgesellschaft erfordert ein Ausmaß an Mobilität und Flexibilität, das viele unserer Klienten überfordert. Dabei stehen Kontinuität und Planungssicherheit, die für den Aufbau von Beziehungen und die Familiengründung unabdingbar sind, in einer gewissen Spannung zur Forderung nach Mobilität und Flexibilität, wie sie für die Arbeitswelt wichtig sind. Flexibilität bezieht sich dann nicht nur auf Arbeitsinhalte oder Arbeitsorte, sondern auch auf Beziehungen.
- Da ist zum Beispiel der Bankangestellte, dem eine Beförderung in Aussicht steht, falls er sich qualifiziere, was eine Versetzung mit sich bringt. Die Beförderung wird ihm zugesagt, er muss jedoch bereit sein, außerhalb eine Filiale zu übernehmen. Zu Hause wohnt er jedoch im noch nicht abgezahlten Haus, das auf dem Grundstück seiner Eltern steht, die - alt und pflegebedürftig - von seiner Frau versorgt werden. Die Eltern hatten dem Sohn das Grundstück geschenkt in der Erwartung, im Alter nicht allein zu sein. Dieser Mann kann nicht einfach mit Sack und Pack wegziehen! Solche Fälle sind nicht selten. Sie führen zu Arbeitstagen von 12-14 Stunden und mehr. An den Wochenenden wird z.B. erwartet, an Fortbildungen teilzunehmen bzw. Arbeitsüberhang zu Hause zu erledigen, so dass die Anforderungen aus den unterschiedlichen Lebenssphären in starkem Widerspruch zueinander stehen, die die Problemlösungskompetenz des Einzelnen überfordern können.
Kann man also sagen, dass die Art wie Arbeit und Arbeitsprozesse heute strukturiert sind, in der sehr viel Arbeit auf wenige Arbeitnehmer konzentriert wird und andererseits viele außen vor bleiben, für beide Gruppen enorme Probleme erzeugt?
- Ja! Die konkreten Auswirkungen von Arbeit haben und arbeitslos sein sind unterschiedlich, in beiden Fällen sind die Familien jedoch gefordert, ganz neue Wege zu suchen, neue Strukturen, mit ganz viel Phantasie auch Familienleben neu zu gestalten.
- Problematiken, die hier entstehen, sind immer wie Mosaike. Sie setzen sich aus vielen, vielen Steinchen zusammen. Einseitige Schuldzuweisungen an Arbeitgeber, Schwiegermütter, an wen auch immer sind zwar psychologisch verständlich, da sie zur Schuldabwehr beitragen. Nur tragen sie nichts zur Lösung bei, da man immer wartet, dass andere handeln und eine Situation in der gewünschten Weise beeinflussen. Ziel der Beratung ist deswegen immer auch die Stärkung der individuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.
Der gestresste Arbeitnehmer muss für sich also Mittel und Wege suchen und entwickeln, zu entspannen und emotional wieder ansprechbar zu werden. Wie kann nun der Arbeitslose mit seinem verletzten Selbstwertgefühl zurechtkommen?
- Ich denke, für den Arbeitslosen ist wichtig, Arbeit und Selbstwertgefühl zu entkoppeln. Er braucht die Erfahrung, dass er als Mensch unabhängig von Arbeit oder Arbeitslosigkeit den gleichen Wert hat. Auch da sind Phantasie und Kreativität gefordert! Welche anderen Lebensformen gibt es? Es ist ja nicht so, dass der Arbeitslose gar nichts mehr kann! Er ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt schlecht vermittelbar, aber es gibt viele andere Möglichkeiten tätig zu sein.
- Es gibt auch viele Projekte, die solche Leute auffangen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass neben finanziellen Veränderungen Arbeitslose auch geistige Flexibilität brauchen um zurechtzukommen.
[Seite 25] Sie leiten eine kirchliche Beratungsstelle. Ist zu spüren, dass der Glaube für die Menschen einen Trost
darstellt, eine Hilfe z.B. beim Wiederaufbau des Selbstwertgefühls?
Sie leiten eine kirchliche Beratungsstelle. Ist zu spüren, dass der Glaube für die Menschen einen Trost
darstellt, eine Hilfe z.B. beim Wiederaufbau des Selbstwertgefühls?
- Ich glaube schon, dass der Glaube Trost und Ansporn sein kann. Allerdings glaube ich nicht, dass die Menschen bewusst danach suchen. Arbeit und Arbeitslosigkeit sind eher etwas, das dem gesellschaftlichen Wandel zugeordnet wird. Da sucht kaum jemand eine spirituelle Lösung.
D.h. Sie erleben es nicht, dass jemand sagt, ich habe da ein Problem, da werde ich jetzt um die Lösung beten?
- Nein, das habe ich noch nie gehört! Vielleicht tut das der eine oder andere, aber die Leute sprechen nicht darüber.
Wie sieht es nun mit den Kindern aus im Zusammenhang mit der Arbeitssituation der Eltern?
- Für Kinder ist es immer schwierig, wenn sie Elternteile haben, die mit sich und ihrer Situation schlecht zurechtkommen, unzufrieden sind, unausgeglichen, und die eigentlich ihrem eigenen Selbstwertgefühl hinterherlaufen. Eltern haben nach wie vor eine Orientierungsfunktion, und ein unsicheres Orientierungsbild macht es dem Kind schwer, in der Entwicklung einen Halt oder eine Linie zu finden.
Stellen Sie in der Beratung Unterschiede zwischen den Generationen fest?
- Unser Umfeld hier in der Eifel bietet im Moment einen recht guten Spiegel für den sozialen Wandel. Wir finden hier durchaus noch Vorstellungen und Normen, die sehr traditionell geprägt sind, gleichzeitig aber auch Überzeugungen, die sich dem gesellschaftlichen Wandel stark angepasst haben, die flexibel sind, mit moderneren Strukturen. Ich habe den Eindruck, dass diese Haltungen hier sehr, sehr heftig aufeinanderprallen! Einerseits geben Eltern noch ihren schon erwachsenen Kindern ganz klare Vorgaben, wie das Leben in Arbeit und Familie zu funktionieren hat, andererseits machen die Kinder ganz andere Erfahrungen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld. Die Konfrontation ist auch deshalb hier so stark, weil beide Ansichten so dicht beieinander leben, manchmal noch im gleichen Haus, vielfach jedenfalls im Nebenhaus oder zumindest in derselben Straße. Da wurde Wiesenland, das aus Zeiten der landwirtschaftlichen Nutzung noch vorhanden war, zu Bauland umgewandelt und Eltern wie Kinder, ganze Familienclans bauen so in unmittelbarer Nähe. Dadurch ist der gegenseitige Einfluß noch recht groß, denn man beobachtet sich, ob bewusst oder unbewusst, und wenn der andere anders lebt, macht das erst einmal unsicher.
- Ganz katastrophal wird diese Situation, wenn eine Trennung oder Scheidung bevorsteht, denn dann ist oft kaum zu regeln, wer das Haus behält bzw. wem es überhaupt gehört. Womöglich ist das Grundstück immer noch auf die Eltern eingetragen, oder die Kinder haben ans Elternhaus angebaut ohne vernünftige bauliche Trennung.
- Ein Vorteil, den andererseits der ländliche Raum bietet, ist für viele Ältere die Eingebundenheit in die Dorfgemeinschaft, z.B. im Vereinsleben. Da wird doch oft ein Ausgleich gefunden außerhalb finanzierter Arbeit.
Gibt es etwas, das Ihnen auf der Seele brennt zum Thema Arbeit/Arbeitslosigkeit?
- Die Fürsorge der Arbeitgeber für Ihre Mitarbeiter liegt mir manchmal auf der Seele. Sie sollten neben der Bereitstellung von Arbeit einen Blick auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter werfen. Denn Alkoholmissbrauch, depressive Verstimmungen, Überschuldung usw. haben auf Familien wie auch auf Arbeitsprozesse weitreichende Auswirkungen.
Stellenanzeigen[Bearbeiten]
Weltweit operierendes Dienstleistungsunternehmen sucht
MANAGER/IN für leitende Position
Erwartet werden fundierte Kenntnisse für eigenverantwortliche Tätigkeit in folgenden Bereichen:
Kindererziehung, Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaft, Ernährungswissenschaften (einschl. Diätküche bei Erkrankungen der Betriebsangehörigen), Wäscherei, Raum-, Gebäude- und Gartenpflege, Transportwesen, Entsorgung, Schlichtung, Einkauf, Animation und Eventorganisation, Handwerk, Sekretariat, Finanzverwaltung, Marktforschung, Archiv, EDV, Dekoration, Psychologie, Moderation, Telefonzentrale und erster Hilfe.
Darüberhinaus sollten Bewerber/innen bereit sein, der Entwicklung der jeweiligen Filiale entsprechend sich binnen kürzester Zeit selbständig nebenher Kenntnisse aus Sparten anzueignen, für die sie nicht ausgebildet wurden. Verhandlungsgeschick mit Handel und Behörden wird vorausgesetzt, ehrenamtliches Engagement im Betriebsumfeld (EIternbeirat, Nachbarschaftshilfe, Vereine, Kirchen und Gemeinde) gern gesehen.
Geboten wird:
▪ absolut krisensicherer Arbeitsplatz bis ins hohe Alter
▪ je nach Betriebsgröße 70-85 Std.-Woche (24-stündige Einsatzbereitschaft sowie unkommentiertes Ableisten von Überstunden inbegriffen)
▪ Krankenversicherung (übrige soziale Absicherung [Rente, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit durch Kündigung bei schlechtem Betriebsklima] muss der Bewerber privat vornehmen)
▪ Bezahlung: Kost, Logis und eventuell die Zuneigung der Betriebsangehörigen, Taschengeld auf Anfrage
Sind Sie stark motiviert, multitalentiert, geduldig, unbegrenzt belastbar,
risikofreudig, flexibel und verfügen über teamorientierte Führungsqualitäten,
richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das weltweit größte Dienstleistungsunternehmen:
HAUSHALT!
Unbezahlte Arbeit[Bearbeiten]
Hätten Sie's gewusst? Nach einer Studie des Statistischen Bundesamtes1) wurden 1992 im gesamten Bundesgebiet für Erwerbsarbeit 60,0 Mrd. Stunden aufgewendet, für unbezahlte Arbeit im Haushalt 96,6 Mrd. Std. Die unbezahlte Arbeit ist demnach um 59% zeitaufwendiger als die bezahlte. Obwohl diese Studie in der Berechnung der erwirtschafteten Leistung von einem Stundenlohn von DM 25,- brutto ausgeht (im Vergleich: für ehrenamtliche Arbeit in Sportvereinen wird DM 30,-/Std. angesetzt), stellt sie fest, dass im Haushalt ein Gegenwert von DM 1427 Mrd. erarbeitet wird, in der Erwerbstätigkeit dagegen DM 1163 Mrd. Würde ein gerechtfertigter Stundenlohn zugrunde gelegt, sähe das Verhältnis noch wesentlich drastischer aus.
Unsere Gesellschaft lebt von der unentgeltlichen Arbeit unzähliger Familienfrauen (Männer findet man in dieser Position nach wie vor nur in verschwindend geringer Anzahl). Aber wir leben nicht gut davon. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, die ethische Bedenklichkeit der mangelnden Würdigung (materiell und moralisch) der Grundlage einer Gesellschaft zu erläutern. Dazu sei u.a. auf TEMPORA Nr. 4 - FRAUEN hingewiesen ( „Aufbruch der Frauen“). Festzuhalten bleibt, dass viele gravierende Probleme in zwischenmenschlichen Bereichen aus der mangelnden Anerkennung der Leistung einer sehr großen Bevölkerungsgruppe entstehen. Solange die Sorge um Kinder und Alte geringer geschätzt (und damit bewertet) wird als die um Turngeräte, ist es um die Lebensqualität und Menschenwürde in einer Gesellschaft nicht gut bestellt!
Aber auch volkswirtschaftlich ist die Missachtung der Familien- und Hausarbeit nicht wünschenswert. Beispiel: Das Fehlen jeglicher Absicherung über Sozialversicherungen führt Jahr für Jahr zu einem Anstieg der Sozialhilfeempfänger/innen in Folge von Scheidungen oder der Erreichung des Rentenalters. Denn obwohl eine Frau vielleicht 45 Jahre lang eine Position entsprechend der vorangestellten Stellenanzeige ausgefüllt hat, hat sie doch im Alter von 65 keinen nennenswerten Anspruch auf eigene Rente. Hätte die Gesellschaft ihre Tätigkeit während ihrer aktiven Zeit angemessen entschädigt, und sei es nur für die Tatsache, dass diese Frau die Rentenzahler von morgen erzogen hat, wäre es ihr möglich gewesen, selbst Rücklagen für das Alter zu bilden und damit der Sozialhilfe zu entgehen.
Heutzutage wünscht ein großer Teil der (zumeist) Frauen, die sich einige Jahre der
Kindererziehung gewidmet haben, den Wiedereinstieg in ihren erlernten Beruf. Abgesehen
von den persönlichen Aspekten auch aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus
[Seite 27] wünschenswert, s.o. Der Prozentsatz der Frauen ohne Berufsabschluss sinkt jährlich.
Doch auch die Rückkehr in den Beruf wird ihnen durch die mangelnde Anerkennung ihrer
Leistung während der Konzentration auf die Familienarbeit erschwert. In einer
Welt, in der fast ausschließlich der erzielte materielle Gewinn zählt, in der nur die
durch ein Zeugnis bescheinigte Erfahrung in einem „anerkannten“ Beruf berücksichtigt
wird, werden die Qualifikationen der Frauen mit Familienpraxis von Personalchefs kaum
wahrgenommen. Dabei können sich diese durchaus sehen lassen! Nach einer Schweizer
Untersuchung2) liegen die durchschnittlichen Qualifikationsanforderungen der
Familien- und Hausarbeit (FHA) in einem Haushalt mit Kindern zwischen denen, die an einen
Amtsvormund und an eine Depart.-Sekretärin gestellt werden. Handelt es sich um einen
noch komplexeren Haushalt, in dem z.B. Alte zu pflegen, Haustiere zu versorgen und
Repräsentationspflichten nach außen wahrzunehmen sind, sind die Anforderungen nach dieser
Studie höher anzusetzen als die an einen Rektor eines Gymnasiums, vergleichbar mit denen
an einen Klinikchef. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Frau, die die FHA leistet,
dadurch einen Schulrektor vertreten könnte, ebensowenig ist allerdings damit zu rechnen,
dass er umgekehrt dazu in der Lage wäre. Wichtig für den Zusammenhang dieses Artikels
ist die Erkenntnis, dass FHA als Berufserfahrung genauso anzuerkennen ist wie die
beschriebenen bezahlten Tätigkeiten.
wünschenswert, s.o. Der Prozentsatz der Frauen ohne Berufsabschluss sinkt jährlich.
Doch auch die Rückkehr in den Beruf wird ihnen durch die mangelnde Anerkennung ihrer
Leistung während der Konzentration auf die Familienarbeit erschwert. In einer
Welt, in der fast ausschließlich der erzielte materielle Gewinn zählt, in der nur die
durch ein Zeugnis bescheinigte Erfahrung in einem „anerkannten“ Beruf berücksichtigt
wird, werden die Qualifikationen der Frauen mit Familienpraxis von Personalchefs kaum
wahrgenommen. Dabei können sich diese durchaus sehen lassen! Nach einer Schweizer
Untersuchung2) liegen die durchschnittlichen Qualifikationsanforderungen der
Familien- und Hausarbeit (FHA) in einem Haushalt mit Kindern zwischen denen, die an einen
Amtsvormund und an eine Depart.-Sekretärin gestellt werden. Handelt es sich um einen
noch komplexeren Haushalt, in dem z.B. Alte zu pflegen, Haustiere zu versorgen und
Repräsentationspflichten nach außen wahrzunehmen sind, sind die Anforderungen nach dieser
Studie höher anzusetzen als die an einen Rektor eines Gymnasiums, vergleichbar mit denen
an einen Klinikchef. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Frau, die die FHA leistet,
dadurch einen Schulrektor vertreten könnte, ebensowenig ist allerdings damit zu rechnen,
dass er umgekehrt dazu in der Lage wäre. Wichtig für den Zusammenhang dieses Artikels
ist die Erkenntnis, dass FHA als Berufserfahrung genauso anzuerkennen ist wie die
beschriebenen bezahlten Tätigkeiten.
Mehr noch: Modernes Management verlangt Persönlichkeitsprofile, die viele Arbeitnehmer in teuren Wochenendseminaren erlernen müssen. Teamfähigkeit, Multitasking, also viele Dinge gleichzeitig zu erledigen und dabei nicht den Faden zu verlieren, die Fähigkeit, in kritischen Situationen besonnen zu handeln, körperliche Regenerationsfähigkeit (nach einer 36-StundenSchicht) etc. Eine Hausfrau ist zumeist perfekt darin, denn ihre Arbeit wird ständig unterbrochen, es gehört zu ihrem Alltag, gleichzeitig (im wörtlichen Sinne) z.B. als Jugendpsychologin („Ich schmeiss die Schule hin!“), Ökotrophologin (Neurodermitisdiät) und Buchhalterin zu arbeiten und nicht die Nerven zu verlieren, wenn ihr während dieser Tätigkeit ein blutüberströmtes Kind vor die Füße fällt, selbst wenn sie wegen schwerer Erkrankungen verschiedener Familienmitglieder das eigene Bett seit 30 Stunden nicht mehr gesehen hat.
Gelegentlich hört man Vergleiche zur „guten alten Zeit“, nach dem Motto „meine Mutter
hat noch die Landwirtschaft geführt und nebenbei 12 Kinder großgezogen!“. Doch gegenüber heute
entspricht das einem Vergleich von Mangos und Weißkohl. In einer Zeit, in der Kinder nicht mehr
zu blindem Gehorsam gezwungen werden, ihr Schulbesuch über die dritte Klasse hinaus
selbstverständlich ist, ihre Fähigkeiten auch neben dem Bücherwissen gefördert werden,
die Hygienevorstellungen das Tragen der Unterwäsche über 7 Tage nicht mehr vorsehen,
niemand mehr 365 Tage im Jahr Kartoffeln mit Kohl isst, dafür Umweltbelastung und
zunehmende Allergien fast jede Hausfrau zur Ernährungsexpertin erziehen und der Umgang
mit moderner Technik immer neue Lernschritte verlangt, sind die Belastungen einfach
andere als zu Zeiten, in denen das blanke Überleben im Mittelpunkt stand. FHA ist nicht
weniger geworden, wie in allen anderen Branchen
[Seite 28] hat sie sich lediglich der modernen Entwicklung angepasst.
hat sie sich lediglich der modernen Entwicklung angepasst.
Mit dem materiellen Wert der FHA müssen sich mangels verbindlicher Maßstäbe zunehmend Gerichte beschäftigen, und zwar dann, wenn eine Frau, z.B. durch Unfall, ausfällt. Fast pikant werden dann entsprechende Urteile, wenn man sie der eingangs erwähnten Zeitstudie gegenüberstellt. Dort war die Arbeitsleistung für Hauswirtschaft mit DM 25,- brutto/Std. angesetzt worden. Das Landgericht Koblenz verurteilte dagegen den Verursacher eines Verkehrsunfalls, einer geschädigten Hausfrau, Mutter zweier minderjähriger Kinder, die ein Hals-Nacken Wirbelsyndrom davongetragen hatte, für die Dauer ihres Ausfalls einen Stundensatz von DM 58,50 zu zahlen. (LG Koblenz, Az. 14S 298/89) Solche Zahlen kommen zustande, wenn man ansetzt, was eine Familie ausgeben muss, um auf dem Arbeitsmarkt Ersatz für die ausgefallene Mutter zu finden.
In der Altenpflege kostet ein Heimplatz derzeit zwischen 5.500,- und 6000,- DM/Monat, ein Häftlingsplatz ebensoviel. Für Hortplätze werden 2-3000,- DM angesetzt. Eine SOS-Kinderdorfmutter betreut 5 Kinder an 5 Tagen die Woche für 5100 DM monatlich brutto(1995) bei voller Sozialversicherung.
Nach diesen Ausführungen macht der Gedanke einer finanziellen Absicherung der in der FHA Tätigen durchaus Sinn. Allein schon die Tatsache, dass eine Familie mit diesem Einkommen der Frau bei ihrem Ausfall nicht mehr darauf angewiesen ist, sich Hilfe auf dem schwarzen Markt zu suchen, ist bedenkenswert. Eine angemessene finanzielle Würdigung der FHA würde es sicherlich auch mancher Familie ermöglichen, die Entscheidung, welches Elternteil die Kinderbetreuung übernimmt, von der individuellen Situation und nicht vom Einkommen des Hauptverdieners abhängig zu machen. Und neben allen volkswirtschaftlichen Erwägungen wäre ein für die Gesellschaft höchst wertvoller Effekt die Bewusstwerdung des absoluten Wertes der FHA für ihre Existenz.
Es gibt schon heute verschiedene plausible Modelle für ein Gehalt für FHA, so z.B. von der
Deutschen Hausfrauengewerkschaft e.V. (dhg), dem Institut für Soziale Ökologie, Bonn oder
[Seite 29] dem Land Sachsen (Sächsisches Modell eines Erziehungsgehaltes, Dr. Hans Geisler, Sächsischer
Staatsminister für Soziales, Gesundheit und Familie). Sie unterscheiden sich in ihrem
inhaltlichen und rechnerischen Einstieg, gleichen sich jedoch in ihrem Realismus. Es ist
allerdings vom gesellschaftlichen Konsens abhängig, ob sich der Gedanke des
Erziehungsgehaltes durchsetzt.
dem Land Sachsen (Sächsisches Modell eines Erziehungsgehaltes, Dr. Hans Geisler, Sächsischer
Staatsminister für Soziales, Gesundheit und Familie). Sie unterscheiden sich in ihrem
inhaltlichen und rechnerischen Einstieg, gleichen sich jedoch in ihrem Realismus. Es ist
allerdings vom gesellschaftlichen Konsens abhängig, ob sich der Gedanke des
Erziehungsgehaltes durchsetzt.
Dabei handelt es sich natürlich auch um eine Gratwanderung. Ein allgemeines Erziehungsgehalt könnte theoretisch als negative Folge die Tendenz zur Anpassung an rein männliche Wertvorstellungen fördern, indem sie die Konzentration wieder ausschließlich auf die Erwerbsarbeit lenkt.3) Die moralisch/ethische Bewertung der FHA käme in einem solchen Fall erneut ins Hintertreffen. Doch andererseits erscheint der Ansatz, Frauen nicht dort stärken zu wollen, wo sie sich erst einfinden müssen, in Chefsesseln und Führungspositionen, sondern vor allem dort, wo sie hier und heute in ihrer Mehrheit vertreten sind, in Familien- und Hausarbeit, sehr einleuchtend. Auf dass das Zitat von Friedrich List4) in Zukunft nicht mehr die scheinbare Realität ausdrücken möge:
„Wer Schweine erzieht, ist .. ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft.“
Elena Afscharian
- 1) aus: „Zeit Im Blickfeld: Ergebnisse einer repräsentativen Zeitbudgeterhebung“, BM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Schriftenreihe Bd.121, 1996
- 2) „Familienkompetenzen - Rüstzeug für den Arbeitsmarkt“, Dr.Kerstin Költzsch Ruch, Edition Soziothek Bern, 1997
- 3) S. Gesa Ebert, „Emanzipation durch Familienarbeit", Dokumentation zum 20jährigen Bestehen der dhg
- 4) in: dhg-rundschau, 2/98
Zu Dank verpflichtet bin ich Frau Wiltraud Beckenbach, Bundesvorsitzende der Deutschen Hausfrauengewerkschaft eV. für die Bereitstellung einer Fülle an Material sowie Frau N. Lacher von der Pressestelle des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein- Westfalen.
Modelle zur Bezahlung der Haus- und Familienarbeit
Deutsche Hausfrauengewerkschaft
Gehalt für Familienarbeit
Die dhg sieht ein Gehalt für Familienarbeit vor, das sich am sozialversicherungspflichtigen Durchschnittseinkommen aller Versicherten orientiert und bezahlt wird, bis das jüngste Kind sechs Jahre alt ist. Das Gehalt enthält Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Damit würde die Erziehung der eigenen Kinder auch im Alter honoriert. Dabei ist eine Delegierung der Erziehungsarbeit und eine Übertragbarkeit des Gehaltes als Möglichkeit vorgesehen. Dieses Gehalt soll als Honorierung einer gesellschaftlich notwendigen Arbeit unabhängig vom übrigen Familieneinkommen gezahlt werden. Bei einem gedachten Betrag von DM 3500,- brutto errechnete die dhg 1995 Gesamtkosten von ca. DM 200 Mrd., wovon nach Rückfluss der Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, sowie einer Einberechnung bereits bestehender familienpolitischer Leistungen noch ca. 70 Mrd. zu finanzieren blieben. Diese Lücke will die dhg durch eine Umwidmung des Solidaritätszuschlages, die Einführung einer Elternversicherung und Steuermittel füllen.
Institut für Soziale Ökologie, Bonn
Erziehungsgehalt 2000
Das 1998 vorgestellte Modell sieht ein steuerpflichtiges Gehalt vor, gestaffelt nach dem Alter der Kinder. Es besteht für alle Eltern aus 2000 DM/Monat für das erste und 1000 DM für alle weiteren Kinder bis sieben Jahre, bei einem Zuschlag für Alleinerziehende von 15%, einkommensunabhängig. Für Kinder von 8-18 Jahren soll ein einkommensabhängiges Gehalt in Höhe von 1400 DM (1.Kind) bzw. 600 DM (weitere Kinder) gezahlt werden. Ein detailliertes Finanzierungskonzept liegt bislang für Kinder bis drei Jahren vor. Der Gesamtaufwand von ca. 57 Mrd. DM für diese erste Phase soll durch automatische Einsparungen (Erziehungsgeld, Sozialhilfe etc.) und Einschränkung des Ehegattensplittings aufgebracht werden. Restlücken sollen entweder durch Abstriche bei den Familienzuschlägen im öffentlichen Dienst oder einen Familienzuschlag auf die Lohn- und Einkommensteuer in Höhe eines Prozentpunktes geschlossen werden.
Dr. Hans Geisler, Sächsischer Staatsminister für Soziales, Gesundheit und Familie
Sächsisches Modell eines Erziehungsgehaltes
Das Modell von 1998 sieht folgende Nettoleistungen vor: Für Kinder bis drei Jahren 1100 DM/Monat, für 4 - 6jährige 800 DM/Monat, unabhängig von eventueller Erwerbstätigkeit oder dem Einkommen der Eltern. Geschätzt werden Gesamtkosten von 53 Mrd. DM bei einer Einführung im Jahr 2000, finanziert durch automatische Einsparungen bei Sozialhilfe, Erziehungsgeld und teilweise in öffentlicher Kinderbetreuung. Der verbleibende Restbetrag von 37 Mrd. DM soll über direkte oder indirekte (Mehrwertsteuer) Steuern erbracht werden.
Quelle: dhg-Rundschau November (4) 98
Kinderarbeit[Bearbeiten]
Niemand will etwas mit ihr zu tun haben, und doch muss jeder damit rechnen, dass er Kinderarbeit unterstützt - wenn auch indirekt und ohne es zu ahnen. Denn nicht nur Luxusartikel wie handgeknüpfte Teppiche können von Kindern produziert sein. Auch ganz alltägliche Produkte wie T-Shirts, Orangensaft oder Fußbälle sind oft durch arbeitende Kinderhände gegangen, bevor sie auf die Märkte der Industrieländer kommen.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass allein in den
Entwicklungsländern 250 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren
arbeiten, Jungen wie Mädchen.1) Das ist jedes vierte Kind dieser Altersgruppe
auf der Welt. Mehr als die Hälfte dieser Kinder leben in Asien, sehr viele in
Afrika und in Lateinamerika. Doch auch im reichen Norden, in Europa und
Nordamerika, arbeiten Kinder unter Bedingungen, die ihrer Gesundheit
schaden und sie am Schulbesuch hindern.
Weltweit sind die meisten arbeitenden Kinder in der Landwirtschaft tätig. Doch Minderjährige hocken auch an Fließbändern in Fabriken, schleppen Zementsäcke auf Baustellen, verrichten Botengänge, putzen Schuhe. Viele schuften im Haushalt, nicht nur dem eigenen, sondern oft für fremde Familien
Bis zu zwei Drittel dieser Kinder verrichten gefährliche oder erniedrigende Arbeiten, verbrauchen sich in Steinbrüchen und Minen, auf Plantagen und in Küchen. Manche werden von ihren Familien an Betriebe verliehen - der Lohn geht direkt an die Eltern. Andere werden gar verkauft, in die nächste Stadt, in fremde Länder. Der sexuelle Missbrauch von Kindern zu kommerziellen Zwecken nimmt zu.
[Seite 31] Das Problem betrifft nicht nur arme Länder. Auch in den westlichen
Industriegesellschaften arbeiten schulpflichtige Kinder und Jugendliche.
Manchmal aus Armut, doch nicht selten, um ihre hohen Konsumansprüche
zu befriedigen, um unabhängig zu sein und um soziale Anerkennung zu
finden.
Das Problem betrifft nicht nur arme Länder. Auch in den westlichen
Industriegesellschaften arbeiten schulpflichtige Kinder und Jugendliche.
Manchmal aus Armut, doch nicht selten, um ihre hohen Konsumansprüche
zu befriedigen, um unabhängig zu sein und um soziale Anerkennung zu
finden.
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes fordert den Schutz vor
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor Arbeiten, die gefährlich sind, die
Erziehung des Kindes behindern, seine Gesundheit gefährden oder seine
körperliche und seelische Entwicklung schädigen. Praktisch alle
Staaten - nicht die USA - haben dieses vor zehn Jahren von den Vereinten Nationen
verabschiedete Übereinkommen ratifiziert. Damit haben sie sich verpflichtet,
praktische Schritte zum Schutz der Kinder zu unternehmen. Dazu zählt die
Festlegung eines oder mehrerer Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit.
Andere Konventionen der ILO, zum Beispiel über das Mindestalter in der
Industrie (1919) oder die Abschaffung der Zwangsarbeit (1957), setzen konkrete
Standards, die aber in vielen Staaten nicht umgesetzt werden. So ist die 1973
beschlossene Konvention über das Mindestalter zum Arbeiten nur von gut
einem Drittel der 174 ILO-Mitgliedstaaten ratifiziert worden. Das Problem:
Die Festlegung des allgemeinen Mindestalters auf 15 Jahre scheint vielen
Regierungen aus praktischer Sicht unrealistisch oder nicht einmal wünschenswert.
Nicht ohne weiteres vereinbar sind die Interessen von Nord und
Süd: die hohen Sozialnormen der ILO und der Industriestaaten auf der einen
Seite, die Konkurrenzvorteile der Billiglohnländer auf der anderen.
Mit einer neuen Konvention hat die ILO nun ein Rechtsinstrument geschaffen,
das zumindest die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit unterbinden soll. Als solche gelten
schwere körperliche Arbeiten, Sklaverei und der
Missbrauch von Kindern zu Zwecken der Prostitution,
der Pornographie und des Drogenhandels. Die Konvention
verbietet solche Arbeiten für alle, die jünger sind als
18 Jahre. Einstimmig haben die Mitgliedstaaten das Dokument
im Juni ‘99 angenommen. Sobald nur 2 Länder die Konvention
ratifiziert haben, tritt sie in Kraft. Zur Umsetzung sollen
die Staaten präventiv gegen Kinderarbeit vorgehen,
Rehabilitierungsprogramme einführen und Verstöße gegen
Bestimmungen der Konvention bestrafen.
Der Kampf gegen die Kinderarbeit ist deshalb so schwierig, weil die
Ursachen vielfältig sind und oft verwurzelt in Kultur und Gesellschaft
eines Landes. Vor allem aber hängen sie mit dem wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungsstand zusammen. Armut ist mit der wichtigste Grund
dafür, dass Kinder arbeiten. Die meisten Jungen und Mädchen verdingen sich,
weil ihre Eltern auf ein zusätzliches Einkommen angewiesen sind. Die
Familien brauchen die Arbeitskraft ihrer Kinder, um zu überleben oder
um Schulden zurückzuzahlen.
WELTWEIT
- arbeiten rund 73 Millionen Kinder zwischen
- 10 und 14 Jahren
ASIEN
- 44,6 Millionen Kinder,
- das sind 13 Prozent der 10-14jährigen
AFRIKA
- 23,6 Millionen Kinder,
- das sind 26,3 Prozent der 10-14jährigen
LATEINAMERIKA
- 5,1 Millionen Kinder,
- das sind 9,8 Prozent der 10-14jährigen
USA
- 5,5 Millionen Kinder,
- davon arbeiten 676.000 schwarz
SÜD- UND OSTEUROPA
- ca. 90.000 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren
- arbeiten in der Gegend um Neapel.
- Quelle: Internationale Arbeitsorganisation ILO und UNICEF, Mai 1999
In Entwicklungsländern bilden Familien oft Kleinstunternehmen,
formal selbständig, doch praktisch gefangen in einem Netz aus
Abhängigkeiten. Damit die Einkünfte reichen, muß jedes Familienmitglied
arbeiten. Finanz- und Wirtschaftskrisen wie in den vergangenen Jahren in
Asien verschärfen die Situation. Sie führen zu Massenentlassungen, wodurch
Millionen von Familien verarmen. Ohne regelmäßiges Einkommen haben sie
meist keine andere Wahl, als ihren
[Seite 32] Unterhalt als familiäre Zulieferbetriebe durch Heimarbeit zu verdienen.
Während die globalisierten Märkte dafür sorgen, dass die immense Nachfrage
nach Billigprodukten nicht abreißt.
Unterhalt als familiäre Zulieferbetriebe durch Heimarbeit zu verdienen.
Während die globalisierten Märkte dafür sorgen, dass die immense Nachfrage
nach Billigprodukten nicht abreißt.
Als weiteres Problem haben Entwicklungshelfer die grundsätzliche Einstellung zur Kinderarbeit erkannt. Viele Eltern haben, als sie Kinder waren, selbst zum Familienunterhalt beigetragen. Unter Umständen finden sie nichts Ungewöhnliches daran, dass auch ihre Kinder arbeiten und nicht - oder zu kurz - zur Schule gehen. Ein Teufelskreis, denn mangels Bildung droht diesen Kindern ihrerseits Erwerbslosigkeit im Erwachsenenalter, so dass auch sie auf die Arbeitskraft ihrer Kinder nicht werden verzichten können.
Schließlich fehlt es an sinnvollen Alternativen zur Arbeit. Besonders in ländlichen Gebieten gibt es zu wenige Schulen - und zu wenige gute. Dies ist ein Grund für Kinderarbeit etwa in bestimmten Regionen Indiens. Wenn der Unterricht nichts bringt und zudem keinen Spaß macht, mag es Eltern nicht einleuchten, warum sie ihre Kinder dorthin schicken sollten. Deshalb hat Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die Einrichtung von Schulen zu einem wichtigen Teil seines Programms gegen Kinderarbeit in Indien gemacht.2)
In den vergangenen Jahren hat die Bereitschaft auch der Entwicklungsländer
stark zugenommen, Kinderarbeit als Missstand anzuerkennen und anzugehen.
Aus ihrer Sicht besteht die entscheidende Herausforderung darin, das
Entwicklungsgefälle zwischen Nord und Süd auszugleichen. Denn ohne die
Überwindung von Armut und Verschuldung, ohne Wohlstand und soziale Gerechtigkeit
für alle scheint es aussichtslos, dass die wirtschaftliche Ausbeutung von
Kindern weltweit überwunden wird.
Als Irrtum hat es sich erwiesen, die Kinderarbeit isoliert von ihren Ursachen und gegen die Interessen der betroffenen Länder zu bekämpfen. Rechtliche Normen und Verbote, die nicht die soziale Wirklichkeit und die wirtschaftlichen Probleme der betroffenen Staaten berücksichtigen, werden von diesen ignoriert und laufen ins Leere.
Auch ein Boykott bestimmter Waren kann den Kindern, die sie produzieren, eher schaden statt nutzen. Ein jähes Ende des Absatzes stürzt sie unter Umständen in noch größere Armut, in Kriminalität oder Käuflichkeit. So soll eine Sanktionsdrohung der USA an die Textilindustrie von Bangladesh zur Entlassung von rund 50.000 Kindern geführt haben. Die meisten fanden danach nur schlechtere und gefährlichere Arbeiten - manche, wie es heißt, als Prostituierte. In der Türkei stand eine 70 Jahre alte Textilfirma vor dem Ruin, nachdem ihr Hauptkunde, ein schwedisches Bekleidungshaus, alle Aufträge storniert hatte. Hintergrund waren Vorwürfe von Kinderarbeit.
Die Beispiele zeigen, dass Unternehmen es sich immer weniger leisten
[Seite 33] können und wollen, mit Kinderarbeit in Zusammenhang gebracht zu werden.
Der Verbraucher legt zunehmend Wert auf Produkte, die aus ethischer Sicht
einwandfrei sind. Vielfach helfen ihm Warensiegel bei der Wahl. Für Hersteller
und Händler werden solche Label zu einem Pluspunkt gegenüber der Konkurrenz. So
ist das Bewusstsein des Verbrauchers heute ein wichtiger Ansatzpunkt im Kampf
gegen die Kinderarbeit.
können und wollen, mit Kinderarbeit in Zusammenhang gebracht zu werden.
Der Verbraucher legt zunehmend Wert auf Produkte, die aus ethischer Sicht
einwandfrei sind. Vielfach helfen ihm Warensiegel bei der Wahl. Für Hersteller
und Händler werden solche Label zu einem Pluspunkt gegenüber der Konkurrenz. So
ist das Bewusstsein des Verbrauchers heute ein wichtiger Ansatzpunkt im Kampf
gegen die Kinderarbeit.
Die Chance besteht darin, dass Hersteller und Importeure auf die Produktionsverhältnisse vor Ort Einfluß nehmen können. Statt sich von einem Fabrikanten zu trennen, der gegen die Menschenrechte verstößt, können sie ihn drängen, Volljährige zu beschäftigen, höhere Löhne zu zahlen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und vor allem: Falls Kinder entlassen werden, sollte es die Wirtschaft als ihre Verantwortung empfinden, sie in Schulen unterzubringen. Schließlich hat sie vom Einsatz der Kinder profitiert.
Zudem signalisiert der moderate Erfolg von Warensiegeln, dass immer mehr Konsumenten bereit sind, einen Aufpreis für fair hergestellte Produkte zu zahlen. Die Unternehmer können also ihre Mehrkosten an den Verbraucher weitergeben, wenn sie ihren Teil dazu beitragen, dass Kinderarbeit eingedämmt wird.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass nur ein Teil der von Kindern
hergestellten Produkte exportiert wird. Unverzichtbar ist insofern die Einsicht
in den betroffenen Ländern selbst. Deren Regierungen müssen den politischen
Willen aufbringen, zusammen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern - und notfalls
gegen sie - den Arbeitseinsatz von Kindern zu reduzieren. Solange die vollständige
Abschaffung unrealistisch ist, wird es darum gehen, Kinderarbeit so zu gestalten,
dass sie mit angemessener Schulbildung vereinbar ist.
Schließlich muss sich auch in der Bevölkerung die Erkenntnis durchsetzen, dass Bildung eine Investition in die Zukunft ist. Aufklärungskampagnen, unter Einbeziehung von Religionsführern, Ärzten und anderen Eliten, können Eltern davon überzeugen, ihren Nachwuchs in die Schule zu schicken.
Ein schnelles Ende der Kinderarbeit überall auf der Welt scheint kaum erreichbar.
Zu groß und komplex ist das Problem. Internationale Menschenrechtsnormen markieren
das Ziel, brauchen aber Zeit, um ihre Kraft zu entfalten. Der Weg dorthin fordert
viele kleine Schritte von Regierungen, Wirtschaft, Hilfsorganisationen und den
direkt oder indirekt betroffenen Menschen. Nur wenn sie Hand in Hand arbeiten,
getragen von einem globalen Verantwortungsbewusstsein, werden immer mehr Kinder
ihre Rechte in Freiheit wahrnehmen können.
- Jens-Uwe Rahe
- Der Autor studierte Islamwissenschaft in Münster, Kairo und Bonn.
- Er arbeitet als Nachrichtenredakteur beim Fernsehen.
- 1) Vgl. Assefa Bequele, International Labour Office Geneva: Child Labour: Targeting the Intolerable, Rede vom 30. Oktober 1998, ILO-Website (www.ilo.org)
- 2) Vgl. Petra Isselhorst: Eine bessere Zukunft für Kinderarbeiter in Indien, in: Unicef-Nachrichten, Zeitschrift des Deutschen Komitees für Unicef, Nr. 1/1999, S. 10-11
Lesezeit[Bearbeiten]
KINDERARBEIT
Tabu des Nord-Süd-Konfliktes
Eine Neuerscheinung des IKO-Verlages für Interkulturelle Kommunikation mit dem Titel "ARBEITENDE KINDER STÄRKEN, Plädoyers für einen subjektorientierten Umgang mit Kinderarbeit" gehört zu den interessantesten aktuellen Beiträgen zur Diskussion um den Arbeitsbegriff, den Nord-Süd-Konflikt und die Situation der Menschenrechte weltweit.
Kinderarbeit - Was ist das? Kaum jemand, der sich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
verpflichtet fühlt, würde der Forderung nach ihrer Abschaffung widersprechen. Doch die
Verallgemeinerung, die zumeist mit dieser Verurteilung der Tätigkeit von Millionen von Kindern
weltweit einhergeht, stellt oft in sich eine Mißachtung von Menschenrechten dar. Die Autoren
dieses Buches zeigen mit eingehenden Analysen der Zustände in verschiedenen Ländern (Peru,
Nicaragua, Indien, Deutschland u.s.w.), dass nur eine differenzierte Betrachtung dieses
Themenkomplexes den Kindern und Jugendlichen gerecht wird.
„Die Kinderarbeit ist wahrscheinlich eine der schicksalhaftesten und dramatischsten Ausdrucksformen der Arbeit. Vielleicht spielt das Ineinandergreifen von Ethik, Wirtschaft und Arbeit eine Schlüsselrolle beim Verdeutlichen dessen, was mit der Menschheit heute los ist.“
Alejandro Cussiánovich, Philosoph und Pädagoge, Begleiter der Kinderbewegung MANTHOC, Lima, Peru
Der generellen Verurteilung der Kinderarbeit stellen die Autoren ihre „Kritische Wertschätzung“
gegenüber. „Die Betonung der Identität des arbeitenden Kindes“ dient nach ihren Untersuchungen
der Stärkung ihres Selbstwertgefühls (und damit ihrer Fähigkeit, sich gegen Unterdrückung zu
wehren), ihrer sozialen Integration und der Erziehung zu Selbstverantwortung. Arbeit ist in
diesem Kontext nicht nur Mittel
[Seite 35] zur Sicherung des Unterhaltes sondern auch zur Familiensolidarisierung, zur Identitätsfindung
und eine Überlebensstrategie
zur Sicherung des Unterhaltes sondern auch zur Familiensolidarisierung, zur Identitätsfindung
und eine Überlebensstrategie
„Die Kinderarbeiter hören, sie ernst nehmen ist Grundvoraussetzung für sinnvolle Aktionen gegen ausbeuterische Kinderarbeit.“
Albert Recknagel, Referent für Südamerika bei terre des hommes, Programme mit arbeitenden Kindern, Straßenkindern, Frauen und indianischen Gemeinschaften
„Die arbeitenden Kinder selbst sollen nicht nur als passive Opfer verstanden werden, sondern als aktive Subjekte, die in der Lage sind bzw. sein müssen, verantwortlich zu handeln und Kompetenzen zu entwickeln, um ihren Alltag zu bewältigen... Damit werden Kinder selbst als Protagonisten in eigener Sache verstanden, die in der Lage sind, sozusagen 'von unten nach oben' soziale Veränderungen anzustoßen.“
Ursula Velten, Diplom-Pädagogin, Forschung über alternative Ansätze in der pädagogischen Praxis mit arbeitenden Kindern in Nicaragua
In Lateinamerika, Afrika und Indien gibt es bereits beachtliche Aktivitäten von Kindern
und Jugendlichen, die sich organisiert haben, um ihre eigene Situation zu verbessern. Allmählich
werden diese Selbsthilfeprojekte wahrgenommen und von Organisationen wie terre de hommes mit
Kampagnen wie „Den Kindern eine Stimme geben“ unterstützt. Geistige Grundlage
dafür bilden Erkenntnisse wie diese:
„Die Kinderarbeit ist kein isoliert dastehendes Problem, welches man mit Hilfe von Gesetzen lösen kann. Wenn man das Problem lösen will, muss man gegen das System der Ungleichheit und des institutionalisierten Elends vorgehen...“
Jose Roberto Novaes, Mitarbeiter der internationalen Zeitschrift NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, in Südamerika übliche Bezeichnung für die sich organisierenden arbeitenden Kinder und Jugendlichen), Brasilien
Bisher vor allem von den Industrienationen angewandte Modelle zur Lösung des Problems gehen von einem Kindheitsbegriff aus, der im Europa des 18. und 19. Jhdts. geprägt wurde, der Kinder als passive, schutzbedürftige Objekte der Aufsicht und Erziehung sah. Ebenfalls aus dem Zeitalter der Industrialisierung in Europa stammt der Ansatz, dem Phänomen Kinderarbeit mit gesetzlichen Verboten beizukommen. Er berücksichtigt nur den staatlicherseits kontrollierbaren Bereich der Industriearbeit, ohne die Motive der Familien zu beachten, die zu Kinderarbeit führen. Dabei ist die verallgemeinernde Vorstellung, Arbeit sei schädlich und es gehe nichtarbeitenden Kindern besser „ignorant gegenüber kulturellen Traditionen, in denen die Kinder vornehmlich durch Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben sozialisiert und gebildet werden“, wie z.B. in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
Manfred Liebel, Prof. für Soziologie an der TU Berlin, Internationale Kindheits- und Jugendforschung, Berater von Projekten mit marginalisierten Kindern und Jugendlichen und der Bewegung der arbeitenden Kinder in Zentralamerika.
Das generelle Verbot der Kinderarbeit führt nur zum Abgleiten der Kinder in schutzlose Illegalität. Dagegen führt das Recht auf Arbeit zu einklagbarem Schutz. „Solange die Arbeit von Kindern als anrüchig gilt, werden keine Anstrengungen unternommen, Arbeitsgelegenheiten und -formen zu schaffen, die für die Kinder hilfreich sind und ihre persönliche Entwicklung fördern.“ Manfred Liebel
Schule statt Arbeit ist solange kein wirksames Konzept, solange sie den arbeitenden Kindern weder nützlich noch attraktiv erscheint. Ein unreflektiertes Übertragen westlicher Schulmodelle in Länder Lateinamerikas, Afrikas oder Asiens schafft neue Probleme anstatt zu helfen.
Übrigens ist Kinderarbeit nicht auf südliche Länder beschränkt. „In Deutschland ist Kinderarbeit ein Massenphänomen. Nicht weniger als die Hälfte der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen geht heute einer Erwerbsarbeit nach.“ Manfred Liebel
In diesem Zusammenhang ist die Analyse und Definition des Begriffes Arbeit interessant, wie sie in diesem Buch vorgenommen wird. Sie ist sowohl vom Kulturraum als auch von der historischen Epoche abhängig, Stichworte „Gesellschaften ohne ein spezifisches Arbeitskonzept“, „Die Arbeit als Religion“ oder „Das moderne Arbeitskonzept“.
Weltweit sind sich alle Verfechter der Kinderrechte einig darin, dass die schlimmsten Formen der Kinderarbeit abgeschafft werden müssen. Uneins sind sich die Betroffenen und westliche Hilfsorganisationen noch in der Einstufung des überwiegenden Teils der von Kindern ausgeübten Tätigkeiten. Das Votum der in diesem Buch zu Wort kommenden Kinder ist eindeutig: „Aus der Erklärung des V. Treffens arbeitender Kinder Lateinamerikas und der Karibik (Vertreterinnen aus Argentinien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien, Chile, Ecuador, Peru, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und der Dominikanischen Republik) an die internationale Gemeinschaft, Lima 6.-9. August 1997:
- JA zur Arbeit in WÜRDE, NEIN zur Ausbeutung!
- JA zur Arbeit unter SCHUTZ,
- NEIN zu schlechter Behandlung und Missbrauch!
- JA zu ANERKENNUNG DER ARBEIT,
- NEIN zu Ausschluss und Ausgrenzung!
- JA zu Arbeit unter MENSCHLICHEN BEDINGUNGEN,
- NEIN zu unwürdigen Bedingungen!
- JA zum RECHT, IN FREIHEIT ZU ARBEITEN,
- NEIN zur Zwangsarbeit!“
- ARBEITENDE KINDER STÄRKEN - Plädoyers für einen subjektorientierten Umgang
- mit Kinderarbeit; Hrsg.: M. Liebel, B. Overwien, A. Recknagel,
- IKO- Verlag für Interkulturelle Kommunikation, ISBN 3-88939-455-8
Neue Arbeit[Bearbeiten]
- von Prof. Frithjof Bergmann
Im Jahre 1984 gründete Prof. Bergmann nach zehnjährigen Bemühungen das Zentrum für Neue
Arbeit (Center for New Work) in der fast ausschließlich von Automobilarbeitern bewohnten
Stadt Flint bei Detroit, dem weitere solche Zentren in den USA und Kanada folgten. Seit
1994 haben seine Ideen auch in Deutschland Fuß gefaßt. In den neuen Bundesländern unterstützt
Prof. Bergmann Selbsthilfeprojekte, die den Kampf gegen die weit verbreitete Arbeitslosigkeit
aufgenommen haben. So entsteht in Wolfen bei Halle auf dem Gelände der ehemaligen ORWO-Chemiewerke
ein Gewerbepark, in dem alternative Energienutzung, neue, auf Eigeninitiative und Zusammenarbeit
beruhende Beschäftigungsstrukturen und die Integration von Lebens- und Arbeitsstätten
erprobt werden.
Ausgangspunkt der Überlegungen Bergmanns war der Gedanke, dass aufgrund der sich rasant verändernden Lebens- und Arbeitsbedingungen eine systematische Neubewertung aller mit dem Job-System verbundenen Aspekte überfällig und zwingend notwendig ist
DER FREIHEITSBEGRIFF
In seinem 1978 erschienen Buch „On Being Free“ hatte Bergmann die Grundlagen des vor allem im Westen vorherrschenden Arbeitsbegriffs untersucht. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Gleichsetzung von Freiheit mit Ungehemmtsein, die in der Illusion wurzelt, man könne sich in einer schrankenlosen Welt bewegen, verhängnisvolle Folgen habe. Denn das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt führt letztendlich in die Sackgasse der Abhängigkeit der Schwachen von den Starken, in Selbstentfremdung, Isolation und Vereinsamung.
[Seite 37] Bergmann definierte Freiheit als eine, die es dem Menschen erlauben soll, solche Tätigkeiten
auszuführen, die für ihn wesentlich und von Bedeutung sind.
Bergmann definierte Freiheit als eine, die es dem Menschen erlauben soll, solche Tätigkeiten
auszuführen, die für ihn wesentlich und von Bedeutung sind.
„Was ist, wenn die Möglichkeit, Vorschläge einzubringen oder hier und dort geringen Einfluss auszuüben, nicht genügt? Was wäre, wenn die Arbeit nur dann als frei zählen würde, wenn man dafür ein tiefes Engagement voraussetzte? Was wäre, wenn es mehr als ein Job sein müsste, eher eine Art Sendung, eine Berufung?
Im Laufe unserer zehnjährigen Erfahrung haben wir versucht, diese intellektuelle Neuorientierung in der Praxis umzusetzen. Die Wirkung ist sehr stark gewesen. Die bloße Vorstellung, dass sie zu einer Berufung oder zum Streben nach Höherem fähig seien, bewirkt bei Arbeitern eine radikale und tiefgreifende Änderung. Für die meisten ist es eine ganz neue Erfahrung, ernsthaft und in aller Ruhe in einer Umgebung, die die Bereitschaft erkennen lässt, viel Zeit für die Entdeckung der Antwort aufzuwenden, gefragt zu werden, was sie allen Ernstes und mit Engagement WOLLEN. Es ist, als ob man mitten in der Nacht wachgerüttelt würde. Für die meisten Arbeiter ist das bisherige Leben ein langer Akt der Resignation, des Hinnehmens, ein Scheintod gewesen. Die Vorstellung, dass das, was sie tief im Inneren und mit allem Ernst WOLLEN, wichtig sein könnte und dass sich daraus Handlungsmöglichkeiten und Erfüllung ergeben könnte, stellt ein Wiederauferstehen dar!“
DAS BESCHÄFTIGUNGSSYSTEM
In einem zweiten Schritt untersuchte Prof. Bergmann das Job-System und die ihm innewohnenden Mängel.
Als Hauptproblem fiel dabei sofort die Arbeitslosigkeit ins Auge. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die tatsächliche Arbeitslosigkeit weit höher liegt als die offiziellen Statistiken zeigen, da als arbeitslos nur die gezählt werden, die noch bei den Arbeitsämtern als Arbeitsuchende registriert sind. Sozialhilfeempfänger, Obdachlose, Teilzeitarbeiter werden nicht mitgerechnet. Bergmann schätzt, dass in den USA statt der offiziell angegebenen 5% eher 18 bis 23% tatsächlich ohne Arbeit sind.
Auch in Deutschland müsste die Zahl von 4 Millionen Arbeitsuchenden mindestens verdoppelt werden, um die realen Verhältnisse zu beschreiben.
Ein weiterer Mangel ist die gleichzeitig existierende Arbeitskräfteknappheit. Diese hat ihre Ursache in dem enormen Anwachsen der Qualifikationsanforderungen in vielen modernen Berufen. Dem steht eine in vielen Bereichen sinkende Qualifikation in Schule und Ausbildung gegenüber, was einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung zu Randtätigkeiten, Aushilfs- oder Teilzeitarbeit verurteilt.
- Gewerbepark Wolfen
- bei Halle
[Seite 38] In den USA brechen ungefähr die Hälfte der Oberschüler ihre Schulausbildung ab und
erwerben nie mehr die für einen vernünftig bezahlten und dauerhaften Arbeitsplatz
erforderliche Qualifikation. Ihr Mangel an Motivation hat natürlich verschiedene
Ursachen. Dazu gehören die schlechte Qualität der für sie in Frage kommenden
Arbeitsplätze, die verbreitete Hoffnungslosigkeit, nach Schulabschluss einen
angestrebten Arbeitsplatz zu finden, die Verführung durch eine materielle
Wertorientierung und der Zugang zu Einkünften aus Drogenhandel und Kriminalität.
In den USA brechen ungefähr die Hälfte der Oberschüler ihre Schulausbildung ab und
erwerben nie mehr die für einen vernünftig bezahlten und dauerhaften Arbeitsplatz
erforderliche Qualifikation. Ihr Mangel an Motivation hat natürlich verschiedene
Ursachen. Dazu gehören die schlechte Qualität der für sie in Frage kommenden
Arbeitsplätze, die verbreitete Hoffnungslosigkeit, nach Schulabschluss einen
angestrebten Arbeitsplatz zu finden, die Verführung durch eine materielle
Wertorientierung und der Zugang zu Einkünften aus Drogenhandel und Kriminalität.
„Nach mehrjähriger Arbeit mit solchen Jugendlichen bin ich in der Tat zu dem Schluss gekommen, dass der größte Einzelschaden, den ihnen die Gesellschaft hat zufügen können, in der Abtötung ihrer Fähigkeit zum Wollen besteht.“
„Spätestens jetzt müsste eine Hauptverbindung klar geworden sein. Wir sagten bereits, dass die Arbeit eine Berufung oder Zielorientierung sein muss, soll sie Bestandteil der Freiheit, des Emanzipationsprozesses werden, d.h. der Mensch muss diese Tätigkeit ernsthaft und innig ausführen wollen. Nun können wir hinzufügen, dass die Arbeit diese Dimension haben muss, wenn sie dem Mangel an Wünschen entgegenwirken soll.“
(Hier endet die redaktionelle Zusammenfassung des Originaltextes.)
PROJEKTE ZUR NEUEN ARBEIT
Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt einige Projekte beschreiben, an denen ich mitgewirkt habe.
Flint, Michigan, eine Stadt, die ausschließlich an General Motors orientiert ist, litt Anfang der 80er Jahre an schmerzlich hoher Arbeitslosigkeit. (Offiziell wurde sie mit 13% beziffert, tatsächlich dürfte die Zahl eher bei 30% gelegen haben.) Die hohe Arbeitslosenquote war jedoch nur der Hintergrund. Im Vordergrund stand die Tatsache, dass sich General Motors noch stärker als die beiden mit ihm konkurrierenden Giganten einer Politik durchgreifender und grundlegender technologischer Innovation verschrieben hatte. Die Kollegen, mit denen ich später das „Center for New Work“ gründete, führten eine umfassende Studie dieser neuen Technologie durch, die nicht nur die Computer und Roboter, sondern auch das System der „Just-intime“ - Lieferung, arbeitssparenden Konstruktionsänderungen und den Einsatz hochmoderner Werkstoffe zum Thema hatte. Auf dieser Grundlage kamen sie in ihrer Bewertung zu der Schlussfolgerung, dass die Gesamteinsparung an Personal bis zu 50% betragen könnte. Die erste Veröffentlichung dieser Einschätzung löste ein Furore aus, inzwischen räumten fast alle Experten jedoch ein, dass sie womöglich noch zu niedrig angesetzt war, dass die Einsparung letztendlich bis auf 65% oder noch höher steigen könnte.
Mit dieser Prognose in der einen Hand und einem Exemplar von „Being Free“ in der anderen begannen wir nach weiteren monatelangen Vorbereitungen mit der öffentlichen Bekanntmachung unseres „New Work“-Vorschlages. Oberflächlich betrachtet erschien dieser Entwurf lächerlich unwahrscheinlich, unglaubwürdig und naiv, aber bei näherem Hinsehen enthielt er bereits die Hauptelemente unserer langsam entwickelten langfristigen Analyse der Entstehungsvorgänge zukünftiger Arbeitsverhältnisse.
Der Vorschlag verkündete im Wesentlichen zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen der
Zukunft Flints. Sollten sich die derzeitigen Trends fortsetzen, ohne dass fantasievoll eingegriffen
[Seite 39] würde, so würde in absehbarer Zukunft die eine Hälfte der Stadtbevölkerung sich mit lähmenden
Überstunden kaputtarbeiten, während die andere Hälfte nicht nur im herkömmlichen Sinne arbeitslos
bleiben würde, sondern sie würde allmählich in einen neuen, noch ungeahnten Schwächezustand
abrutschen: in den Abgrund der Kriminalität, Drogen, Armut und Seuchen.
würde, so würde in absehbarer Zukunft die eine Hälfte der Stadtbevölkerung sich mit lähmenden
Überstunden kaputtarbeiten, während die andere Hälfte nicht nur im herkömmlichen Sinne arbeitslos
bleiben würde, sondern sie würde allmählich in einen neuen, noch ungeahnten Schwächezustand
abrutschen: in den Abgrund der Kriminalität, Drogen, Armut und Seuchen.
Aus der Alternative zu diesem Untergangsszenario wurde unser „6-Monate : 6-Monate“ oder New Work-Plan. Anstelle einer Stadt Flint, in der die halbe Bevölkerung arbeitete und die andere Hälfte nicht, sah dieser Plan Arbeit für alle mit der Schlüsselvoraussetzung vor, dass jeder Einzelne lediglich das halbe Jahr im Betrieb arbeitete und die „arbeitsfreien“ sechs Monate mit anderen Tätigkeiten ausfüllte. Was die Menschen im anderen Halbjahr tun würden und mit welchen Mitteln sie dazu ermächtigt bzw. befähigt werden konnten, das wurde zum Dreh- und Angelpunkt des gesamten „New Work“-Konzepts.
Zum damaligen Zeitpunkt - man schrieb die mittleren 80er Jahre - machte sich ein deutlicher
Trend zur kürzeren Arbeitswoche bemerkbar. Die Vier-Tage-Woche war in aller Munde: Um dem
entgegenzuwirken, konterten wir mit einer eigenen Aussage, die zu einem Baustein unseres
Selbstverständnisses innerhalb der Gruppe wurde: „Vier Tage Arbeit und drei Tage frei“,
sagten wir, „taugen überhaupt nichts, denn drei Tage Urlaub reichen gerade aus, um Schuldgefühle
zu erzeugen, aber nicht, um etwas Sinnvolles damit anzufangen!“ Auf diesem Punkt bestanden
wir hartnäckig. Das Wesentliche in unserem Vorschlag war von Anfang an die Betonung dessen, was die
Menschen mit der Zeit außerhalb des Betriebs anfangen würden. In diesem Punkt waren wir
bereit, kompromisslos und für manche Leute unverständlich extreme Positionen zu beziehen. Wir
vertraten den Standpunkt, dass nicht nur Ärzte, Priester, Künstler oder Wissenschaftler eine
Berufung haben konnten, wobei wir ganz bewusst diesen mit geschichtlich-religiösen Assoziationen
durchtränkten Begriff verwendeten, sondern behaupteten, dass auch gewerbliche Arbeitnehmer
aus den Gruben unter den Autos emporsteigen und eine Arbeit tun könnten, an die sie glaubten,
dass auch sie eine Aufgabe haben konnten, die sie mit Leidenschaft erfüllten, dass für sie nicht
nur eine erleichterte, bequemere, „aufgewertete“ Arbeit das Ziel sein konnte, sondern eine
wichtig-wertvolle Tätigkeit, eben eine Berufung. Sicherlich wussten wir, dass sich dieses utopisch,
ja fantastisch anhörte, und es fehlte nicht an solchen, die spotteten und den Kopf schüttelten.
[Seite 40] Doch gab es bereits sehr früh, schon ab 1981, immer ein paar Leute in Positionen aller Art, einige
wenige Hochgestellte in den Wolkenkratzern der Hauptverwaltungen, andere unten im Betrieb
angesiedelt, die in dieser Idee nicht nur eine weitere kleine Verbesserung, sondern einen
Sonnenstrahl sahen, der die Wolkendecke durchbrach. Für viele wurde sie zum einzigen, klar dargelegten,
gezielten und doch dramatischen, auf eine heitere, freudigere, würdevollere Zukunft gerichteten
Schritt nach oben. Hier und dort fing eine Person oder eine Gruppe Feuer, und seit dem ersten Tag
der Bekanntmachung ist dieses Vorhaben zum Dauerbrenner geworden und breitet sich immer
mehr aus.
Doch gab es bereits sehr früh, schon ab 1981, immer ein paar Leute in Positionen aller Art, einige
wenige Hochgestellte in den Wolkenkratzern der Hauptverwaltungen, andere unten im Betrieb
angesiedelt, die in dieser Idee nicht nur eine weitere kleine Verbesserung, sondern einen
Sonnenstrahl sahen, der die Wolkendecke durchbrach. Für viele wurde sie zum einzigen, klar dargelegten,
gezielten und doch dramatischen, auf eine heitere, freudigere, würdevollere Zukunft gerichteten
Schritt nach oben. Hier und dort fing eine Person oder eine Gruppe Feuer, und seit dem ersten Tag
der Bekanntmachung ist dieses Vorhaben zum Dauerbrenner geworden und breitet sich immer
mehr aus.
Die spezifischen Gründe, weshalb einige der höhergestellten Führungskräfte zum Beispiel bei General Motors dem Vorhaben ihre Unterstützung zusagten, können an dieser Stelle natürlich nur aufgezählt werden. Der Vorstand hat darin verständlicherweise viele potentielle Gefahren gewittert. Wie man beispielsweise Arbeiter „im Griff behalten“ könne, nachdem sie sechs Monate „Freigang“ gehabt haben, war nur die erste von vielen. Aber einige einzelne Inhaber von Machtpositionen erkannten ebenfalls die Überzeugungskraft starker positiver Überlegungen, von denen sich drei Kategorien aufzählen lassen.
Die erste Kategorie, die unmittelbar mit den Alltagssorgen in der Produktion verbunden ist, betrifft so grundlegende Dinge wie die Statistiken über das „Blaumachen“, die Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen, Betriebsunfallquoten, Frührenten- bzw. Ausscheidungsquoten aufgrund von „Ausgebranntsein“, niedrige Produktivität aufgrund von schlafwandlerischer Erschöpfung. Es lagen bereits aus den frühen 80er Jahren gewaltige Mengen Forschungsergebnisse vor, und die Menge hat sich bis heute beträchtlich erhöht, die die These unterstützten, dass flexiblere Arbeitsplanung in sämtlichen bereits genannten Bereichen erstaunliche Verbesserungen bewirken könnte. Jeder, dem die aus diesen Faktoren entstehenden horrenden Kostenbelastungen vertraut sind, begreift sofort, wie die Einführung eines solchen Systems, auch eines so unkonventionellen Systems wie es der Wechsel alle sechs Monate war, sehr wesentlich im Interesse selbst eines Großkonzerns liegen konnte, dessen Blick noch so starr auf die Zahlen unter dem Strich gerichtet sein mochte.
Etwas mehr Abstand hat das Nachdenken über den sozialen Konflikt. Sicherlich nicht alle Führungskräfte, aber doch ein Teil der intelligenteren und weitsichtigeren unter ihnen verschlossen keineswegs die Augen vor dem Gespenst einer möglicherweise gespaltenen, polarisierten Stadt Flint (oder sogar der USA) mit zwei in ihren Lagern verschanzten Armeen. Sie finden keinen Gefallen an der Vorstellung, mit gepanzerten Autos zur Arbeit fahren zu müssen, und sie sind sich natürlich dessen bewusst, dass ein bürgerkriegsähnlicher innerer Konflikt alles andere als, wie es so schön heißt, „gut für General Motors“ wäre.
Darüber hinaus können sie nicht umhin, sich um ihre Kundschaft Sorgen zu machen. Ist es nicht verständlich, dass ein Marketingleiter beim Anblick der Hälfte der Bevölkerung von Flint, bestehend aus erschöpft aussehenden jungen Leuten, die den ganzen Tag lang an die Wand gelehnt herumlungern, oder in Trauben, von Alkohol, Drogen und Sonne betäubt, zusammen auf den Verandas herumliegen, ein Klagelied darüber anstimmt, dass diese Leute niemals als Käufer eines neuen Oldsmobile oder Buick in Frage kommen werden? Von dort führt nur ein kleiner Schritt zur Erkenntnis, dass dies auch für die noch größere Anzahl derer gilt, die einige Wochenstunden in einem Pflegeheim, einer Tagesstätte oder einem Schnellrestaurant ableisten.
Die dritte Kategorie der Überlegungen ist jedoch die gewichtigste. Diese entstammen der
Furcht vor den Japanern. Denn die vorherrschende Meinung in der Automobilindustrie besagt, dass
sich trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten die
[Seite 41] Kluft nicht schließt, weshalb ein Großteil der Industrie das Gefühl hat, der Verzweiflung nahe
zu sein. Vor diesem Hintergrund ist die Anziehungskraft des 2 x 6-Monate-Modells zu sehen.
Wie es in einem Artikel in der „Detroit Free Press“ pointiert heißt: „Die Verzweiflung muss
weit gediehen sein, wenn General Motors nunmehr sogar auf Philosophen hört.“
Kluft nicht schließt, weshalb ein Großteil der Industrie das Gefühl hat, der Verzweiflung nahe
zu sein. Vor diesem Hintergrund ist die Anziehungskraft des 2 x 6-Monate-Modells zu sehen.
Wie es in einem Artikel in der „Detroit Free Press“ pointiert heißt: „Die Verzweiflung muss
weit gediehen sein, wenn General Motors nunmehr sogar auf Philosophen hört.“
Manche Manager sind von dem Modell deshalb fasziniert, weil ihnen die Nachahmung des japanischen Unternehmensstils mit Hymnen an Toyota und Hampelmännern in weißen Overalls nicht durchsetzbar und billig erscheint, wohingegen die starke Betonung der Fantasie, der Initiative und vor allem der Individualität des New-Work-Modells sie glauben lässt, dass es sich hierbei um eine hausgemachte amerikanische Gegenmaßnahme zur Bekämpfung der „Bedrohung aus dem Ausland“ handelt.
Warum ein Teil der Gewerkschaftsführung der Automobilarbeiter U.A.W. (United Automobile Workers) das Modell unterstützt, ist nicht so leicht zu begreifen. Hier spielt wieder der trostlose Hintergrund eine wichtige Rolle. Die letzten Jahre waren düster. Die Gewerkschaftsführung hat Zugeständnisse machen müssen. Alles, was einen Vorgeschmack der Hoffnung gestattet, stößt, besonders wenn es mit einer Prise Dramatik und Wagnis gewürzt ist, zwangsläufig auf Begeisterung. Um es noch zugespitzter auszudrücken, hat die Gewerkschaft mit der jüngeren, eher genussorientierten Generation nicht Schritt halten können. „Es lebe die Solidarität“ läßt das Herz der Jugend nicht höher schlagen. Aber das Bild einer wiederkehrenden Freizeit, in der man den eigenen Interessen nachgehen könnte, spricht das Ethos der heutigen Jugend durchaus an.
Was die Arbeiter betrifft, beruht ihr Interesse natürlich auf den nervtötenden, langen Zeiträumen mit viel Überstunden. Auf der einen Seite ziehen sie daraus ihre ansehnlichen Einkommen (manche Arbeiter können bis zu 50.000 Dollar verdienen, was sicher ihre Bereitschaft untermauert, auf eine Halbzeitrotation einzugehen), aber andrerseits bedeutet es Erschöpfung, dass sie ihr Leben als eine grauenhafte, eintönige Routine erleben, in der jede Unterbrechung als seligmachend empfunden wird. Um die Wahrheit zu sagen, hat das Leben vieler Arbeiter Ähnlichkeit mit einer Sucht oder Alkoholismus. In jungen Jahren waren sie fest entschlossen, nicht in den Betrieben zu „verenden“. Schon ihre Eltern waren „Betriebsratten“ gewesen, und sie wollten mit aller Kraft ein ähnliches Schicksal von sich selbst abwenden.
[Seite 42] Und doch sind sie der Versuchung erlegen, zunächst nur für ein paar Wochen, um rasch etwas
Geld zu sparen, später für längere Zeit, und ehe man sich versieht, ist man schon 20 oder gar 30
Jahre dabei. Die Häufigkeit dieser Lebensgeschichte erklärt, warum die Hoffnung auf längere Freizeit
für Aufgaben, die wirklich eine Erfüllung bringen - für Berufungen -, ein so erstaunlich positives
Echo bei vielen Arbeitern gefunden hat.
Und doch sind sie der Versuchung erlegen, zunächst nur für ein paar Wochen, um rasch etwas
Geld zu sparen, später für längere Zeit, und ehe man sich versieht, ist man schon 20 oder gar 30
Jahre dabei. Die Häufigkeit dieser Lebensgeschichte erklärt, warum die Hoffnung auf längere Freizeit
für Aufgaben, die wirklich eine Erfüllung bringen - für Berufungen -, ein so erstaunlich positives
Echo bei vielen Arbeitern gefunden hat.
Seltsamerweise hat die Bezeichnung des Modells "6 Monate : 6 Monate" ein dauerhaftes Missverständnis hervorgerufen. Viele haben irgendwie den Eindruck bekommen, dass diese Formel unsere Vision einer besseren Zukunft einkapselt; dass unsere Antwort auf das Bild der Stadt Flint mit zwei verschanzten Armeen darin besteht, dass das ganze Land halbjährlich die Rollen wechselt, womöglich noch mit gebündeltem Sirenengeheul zweimal jährlich, das über die Prärien hinweg den Riesenschichtwechsel signalisiert.
Dies lag aber niemals in unserer Absicht. Von Anfang an sollte die Bezeichnung des Modells lediglich als Metapher (als Beispiel) dienen. Wir haben mit Nachdruck zur Kenntnis genommen, dass die Verhältnisse in Flint ausgesprochen einmalig sind. Wir haben daher den halbjährlichen Wechsel nie als Zielvorstellung für eine neue Zukunft angesehen. Insbesondere erschien es uns selbstverständlich, dass das Modell das Problem der ständig anschwellenden Masse der Armen überhaupt nicht löst. Notleidenden Menschen ohne jegliche Arbeit klarmachen zu wollen, dass sie nur sechs Monate im Jahr arbeiten sollen, wäre absurd, abstoßend und aberwitzig.
WEITERE PROJEKTE
Da uns dieses bewusst war, beschlossen wir vor etwa zwei Jahren, Projekte ins Leben zu rufen,
die sich mit den „Kastenlosen“ (out-caste) befassen sollten. Diese Projekte - es gibt derzeit zwei
davon, eines für Obdachlose in New York City und eines für gefährdete junge Menschen in Kenosha,
Wisconsin - sind ebenfalls Ausdruck unseres New-Work-Bekenntnisses, aber ganz anders. Darüberhinaus
spiegelt sich in ihnen noch lebhafter und mit noch größerem Nachdruck als im älteren
Projekt in Flint unsere theoretische Analyse sowie unsere Prognose für die beiden
Zukunftsalternativen wider, die uns nun bevorstehen.
Das Wort „Polarisierung“ erfasst den Kern unseres Verständnisses der Gegenwart, aber auch das wird leicht missverstanden. Es bedeutet nicht eine Spaltung zwischen den Arbeitenden und den Arbeitslosen. Weit gefehlt!
Nach unserer Auffassung gehört selbst der Begriff „Arbeitslosigkeit“ der Vergangenheit an.
Einer der Gründe für diese Ablehnung ist der sprunghafte Anstieg eines vom herkömmlichen
Beschäftigungssystem völlig unterschiedlichen „Systems“. Wir nennen es das „hustle system“
(Auf-den-Strich-geh-System) und es umfasst die Millionen Menschen, die keinen echten Arbeitsplatz
haben, sondern wenige Stunden wöchentlich arbeiten. Diese Gruppe überlappt sich mit
den etwa 50% (!) aller Oberschüler in unseren Städten, die vorzeitig die Schulbildung abbrechen.
Sie werden nicht mehr in das „Job-System“ aufgenommen, und die Population der „Kastenlosen“
wächst von Jahr zu Jahr mit jedem neuen Schub aus den Schulen. Die Gesamtzahl der „Kastenlosen“,
zu denen auch die Menschen gehören, die zwar immer noch einen Arbeitsplatz haben,
deren Lohn jedoch unterhalb der Armutsgrenze liegt, dürfte heute zwischen 35% und 50% der
Bevölkerung betragen. So grob diese Schätzung auch sein mag, gibt die Zahl einen Hinweis
[Seite 43] darauf, in welche Sackgasse unsere Kultur nunmehr geraten ist.
darauf, in welche Sackgasse unsere Kultur nunmehr geraten ist.
Wir befinden uns im Wesentlichen an einem Scheideweg. Wenn wir die Fortsetzung der derzeitigen Trends unverändert zulassen, werden wir nicht nur eine „Südamerikanisierung“ der Vereinigten Staaten erleben. Eine Phrase wie „Allgemeiner Terror“ - die unkontrollierte Ausbreitung von wahllosen Schießereien aus Wut über einen verlorengegangenen Parkplatz - erweckt eher den Eindruck von dem, was uns blühen könnte.
Die mit New Work befasste Gruppe hat vor zehn Jahren diese Vision als ein mögliches, vielleicht inzwischen schon wahrscheinliches Bild der Zukunft vorausgesehen. Als Reaktion darauf entwickelten wir die theoretische Analyse, aber parallel dazu die Verwirklichung einer Reihe von Projekten, die darauf ausgerichtet sind, das Eintreten eines solchen Unglücks zu verhindern und die Fundamente für eine andersartige Zukunft zu legen. Was wäre das für eine Zukunft? Am knappsten läßt sie sich als dreispurige Lebensweise beschreiben.
Man stelle sich Menschen vor, die noch Arbeitsplätze haben, wobei die Arbeit immer weniger von ihrer gesamten Lebenszeit in Anspruch nimmt, während zwei weitere Elemente die Freiräume ausfüllen. Das eine wäre eine Rückkehr zur Selbstversorgung (ohne Rückkehr zur Knochenarbeit in der Landwirtschaft). Neuerdings sprechen wir von „Hi-Tech-Selbständigkeit“ oder „Hi-Tech-Selbstversorgung“. Ein Symbol für einen solchen Lebensstil könnten beispielsweise neue Materialien und Bausysteme zum Bau des Eigenheims wie der neuartige, leichte und benutzerfreundliche weiße Silikonschaum sein. Unser Vorschlag lautet: Entwicklung und Einsatz der Hochtechnologie zum Zwecke der Selbstversorgung. Das andere Element bestünde in der Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Rahmens dergestalt, dass dieser es einer ständig wachsenden Anzahl von Menschen ermöglichte, einer Berufung nachzugehen. Die Hoffnung, die wir für die Zukunft haben, liegt in einer Vision, in der die Menschen weitgehender in der Lage wären, sich selbst zu versorgen, wobei sie gleichzeitig eine Aufgabe hätten, die sie mit Leidenschaft und großer Liebe erfüllen.
„Die Volkswirtschaftler haben ein Weltbild geschaffen, demzufolge man seine Kindheit und einen Teil seiner Jugend damit verbringt, sich darauf vorzubereiten, später seine künftigen Arbeitgeber von sich einzunehmen. Ist man soweit, stellt man sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, um angestellt zu werden. Wenn man keinen Arbeitgeber findet, fangen die Probleme an. Wer das Glück hat, in einem industrialisierten Land zu leben, kann sein Leben als Sozialhilfeempfänger fristen; wer in einem Entwicklungsland lebt, muss mit einer Existenz in Armut und Elend rechnen.
Die Vorstellung, dass ein junger Mensch für einen Arbeitgeber hart arbeiten soll, empört mich. Das erinnert mich an die Zeiten, da die Mütter ihren Töchtern beibrachten, sich kokett und verführerisch zu verhalten, damit sie einen Mann abbekommen. Das menschliche Leben ist viel zu kostbar, als dass man es damit vergeudet, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, um dann sein ganzes Leben lang im Dienst eines Arbeitgebers zu stehen.“
Muhammad Yunus, Grameen - eine Bank für die Armen der Welt, S.284
LEBEN UND ARBEIT[Bearbeiten]
- PERSPEKTIVEN FÜR DIE ZUKUNFT
1. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt
erkennen, dass ohne grundlegende Umdenk- und
Umstrukturierungsprozesse es nicht möglich sein
wird, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
Diese betreffen alle Bereiche des Lebens,
vor allem aber die Erziehung und Ausbildung und
den der Arbeit. Damit werden Veränderungen der
gesamten Lebensgestaltung verbunden sein.
2. In erster Linie verlangt diese Entwicklung einen neuen Menschen. Die Eigenschaften, die von ihm gefordert werden, sind allerdings keine, die seine in ihm liegenden Fähigkeiten übersteigen würden. Es sind vielmehr gerade solche Eigenschaften, die das Wesen des Menschen ausmachen. Ihre Entfaltung wird ein entscheidender Schritt zu seiner Selbstverwirklichung sein.
3. Kreativität, Flexibilität, Selbständigkeit im Denken und Handeln und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, d. h. Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit sind die Schlüsselqualitäten, die den Menschen der Zukunft auszeichnen.
4. Diese Eigenschaften werden ihn in die Lage versetzen, sich dem zunehmenden Tempo gesellschaftlichen Handelns anzupassen und menschengerechte Lösungen zu finden.
5. Die Organisation der Arbeit, aber auch anderer Gesellschaftsbereiche, wird in Zukunft nicht mehr hierarchisch strukturiert sein, sondern immer mehr das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit betonen. Mut und Eigeninitiative werden deshalb Grundbedingungen sein, um die Aufgaben bewältigen zu können.
6. Eine zunehmend vernetzte Welt erfordert ein viel höheres Maß an Zusammenarbeit als dies in der Vergangenheit der Fall war. Daher wird von der Teamfähigkeit der Menschen wesentlich abhängen, ob sie zu Problemlösungen gelangen, die ihre und die Bedürfnisse der Gemeinschaft befriedigen.
7. Gefragt sind vor allem kommunikative Fähigkeiten, Offenheit, vorurteilsfreies Herangehen an Menschen und Probleme, die Fähigkeit Gefühle zu äußern und zuzulassen und die Bereitschaft sich selbst zurückzunehmen und ohne Dominanz- oder Durchsetzungsansprüche gleichberechtigt zu beraten.
8. Spezialisten wird es auch in Zukunft geben, aber sie werden ihre Qualitäten miteinander verbinden und bündeln müssen, sich gegenseitig ergänzen und so ihre Leistungsfähigkeit vervielfachen. Dieser Synergie-Effekt wird nicht nur bessere Ergebnisse, sondern auch eine tiefere innere Befriedigung der Beteiligten hervorbringen.
9. Als neuer Maßstab für die Qualität der Arbeit wird sich das Ausmaß an Identifikation erweisen, mit dem man sie verrichtet. Freude am Tun, Begeisterung und das Gefühl, einer inneren Berufung zu folgen, werden wesentliche Merkmale solcher Tätigkeit sein. Diese Erfahrungen werden sich auch in einer allgemeinen Wertschätzung der Arbeit und ihrer Ergebnisse niederschlagen.
10. Betriebsstrukturen werden vom Prinzip gemeinsamer Verantwortung geprägt sein, viel Raum für Eigeninitiative bieten und genossenschaftliche Merkmale aufweisen. Die Arbeitenden werden über Gewinnbeteiligungen und als Anteilseigner am Betriebskapital auch materiell von ihrer Leistung profitieren.
11. Unternehmerisches Denken wird aber auch
jenseits der traditionellen Arbeitsbereiche gefragt
sein. Der Umfang der bisher hier von Menschen
geleisteten Arbeit wird immer mehr abnehmen,
da sie von Robotern und Computern ausgeführt
wird. In der restlichen zur Verfügung stehenden
Arbeitszeit werden die Menschen ihre sonstigen
Talente nutzen und Eigeninitiative entwickeln
müssen, um als selbständige Kleinunternehmer
Tätigkeiten zu verrichten, die gesellschaftlich
[Seite 45] gefragt sind und zum Lebensunterhalt beitragen.
Durch all dies werden sich Menschen aller Berufe
zunehmend als Gestalter ihres Schicksals und
nicht mehr als hilflose Opfer anonymer Prozesse
erfahren.
gefragt sind und zum Lebensunterhalt beitragen.
Durch all dies werden sich Menschen aller Berufe
zunehmend als Gestalter ihres Schicksals und
nicht mehr als hilflose Opfer anonymer Prozesse
erfahren.
12. Die verbleibende Freizeit wird für soziale, künstlerische oder andere erfüllende Aktivitäten genutzt werden können.
13. Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des menschlichen Potentials wird die freie Verfügbarkeit des Wissens spielen. Via Computer und Internet werden die für die unterschiedlichsten Aufgaben erforderlichen Informationen jederzeit abrufbar und nutzbar sein. Dies wird zu einer Demokratisierung der Bildungsmöglichkeiten entscheidend beitragen. Der Computer als transportabler Arbeitsplatz wird dabei eine viel größere Freiheit bei der zeitlichen und räumlichen Arbeitsplanung ermöglichen.
14. Der Bereich der Erziehung und Ausbildung wird einen Paradigmenwechsel durchmachen müssen, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Die traditionellen Denkmuster, Methoden und Lehrpläne werden durch zeitgemäße und menschengerechte ersetzt werden müssen. Die Defizitorientierung (Betonung der Mängel) im Messen der Leistung, die statt Lernlust Lernfrust bewirkt, wird einer Ressourcenorientierung (Betonung der Fähigkeiten) Platz machen müssen. Die Schule muss Methoden entwickeln, die die individuellen Potentiale wecken und zu Tage fördern. Sie wird statt zusammenhangloses, reproduzierbares Wissen abzuprüfen stärker zu prozessorientiertem Lernen verhelfen, das Lernen in Gruppen ermöglichen, größere Freiräume für die Bewältigung selbstgewählter Aufgaben anbieten und vor allem methodische Kenntnisse und die Fähigkeit zur Selbstorganisation des Lernens und Problemlösens vermitteln.
15. Die Lehrer werden als Wissensvermittler zurücktreten und eher Aufgaben von Lernberatern und Moderatoren übernehmen. Dadurch werden sie Schülern und anderen Auszubildenden ermöglichen, Probleme selbständig zu erkennen und zu lösen, ihre sozialen und Teamfähigkeiten zu entwickeln und die Selbstbestimmung und Selbstorganisation bereits frühzeitig zu erlernen.
16. Auch im Ausbildungs- und Lehrbereich werden Leistungskontrolle und leistungsgerechte Entlohnung Einzug halten, um die Effektivität zu erhöhen und Machtmissbrauch zu verhindern.
17. Bei der Berufsausbildung aber auch schon in der Schule wird die Vermittlung theoretischer Kenntnisse und ihre praktische Anwendung miteinander verbunden werden, um mit der raschen wirtschaftlichen Entwicklung Schritt halten zu können, aber auch um die Ausbildung den Bedürfnissen der Gesellschaft und des Einzelnen anzupassen. Die Verwirklichung der Einheit von Kopf, Herz und Hand bereits in der Ausbildung wird die Menschen zufriedener machen, sie motivieren und in die Lage versetzen, die praktischen Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Der Förderung handwerklicher und künstlerischer Fähigkeiten kommt hierbei eine entscheidende Bedeutung zu.
18. Dadurch werden sie darauf vorbereitet, im Laufe ihres Lebens mehrfach ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit zu wechseln, und in die Lage versetzt, auch nach Ablauf ihrer Berufszeit weiter kreativ, aktiv und produktiv zu sein.
19. Die für das Überleben der Menschheit unabdingbare Einheit von Ökonomie, Ökologie und Ethik wird bereits in den Schulen vermittelt und in die Tat umgesetzt werden müssen, um die Heranwachsenden auf eine verantwortungsbewußte Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft vorzubereiten und ihnen zu helfen, ihre persönlichen Bedürfnisse mit denen der Gesellschaft und Mitwelt in Einklang zu bringen.
ZEITENWENDE FÜE DIE ARBEIT[Bearbeiten]
- „Umdenken oder Untergehen
- Keine Theorie,
- Eine Wahl für uns alle.“
- Frederick Mayer
Was heute immer mehr Vordenker als postmodernen Raubtierkapitalismus bezeichnen, hat wie ein riesiger Krake alle Teile der Erde in seinen Würgegriff genommen und ist dabei, die Lebensadern unseres Planeten zu strangulieren. Auffällig daran ist, dass das schrittweise Absterben nicht mehr Halt macht vor den Toren der Metropolen, der reichen Länder, die einst ungestraft die von ihnen Abhängigen ausbeuten konnten.
In den reichsten Ländern selbst sind durch den Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung und die damit verbundene neue industrielle Revolution, die rasant fortschreitende Computerisierung der Arbeit, immer mehr Menschen freigesetzt worden und müssen nun von denen, die noch Arbeit haben, miternährt werden Nach Schätzungen von Professor Frithjof Bergmann (vgl. Artikel) ist zu erwarten, dass z. B. in hochindustriellen Gebieten wie den Zentren der US-Autoindustrie 50-65% aller Arbeitsplätze verschwinden werden.
Vertraten bis vor kurzem noch einige Fachleute die Ansicht, diese Reduzierung von Arbeitsmöglichkeiten könne durch die Erweiterung des Dienstleistungssektors ausgeglichen werden, so wird inzwischen immer deutlicher, dass dem nicht so ist. Eine Reihe von traditionellen Dienstleistungen wird nämlich selbst zunehmend von Rationalisierungsprozessen erfaßt und computerisiert.
Auch hier wird es zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen. Wo sind die Lösungen, die verhindern, dass immer mehr Menschen zu Untätigkeit, zu einem Schicksal als Almosenempfänger und damit zur schleichenden Persönlichkeitszerstörung verdammt werden? Denn dies scheint klar zu sein, wenn die prophetischen Zeichen einer Entwicklung, wie sie in den USA bereits sichtbar ist, richtig gedeutet werden: Es droht der Zerfall in eine Zweiklassengesellschaft: in eine Gruppe, die all ihre Kraft in die Erwerbsarbeit investiert und sich, von der Angst getrieben, den Arbeitsplatz zu verlieren, unter Dauerstress setzen lässt, und in eine zweite Gruppe von Menschen, die aller Hoffnung auf Gestaltung eines menschenwürdigen Lebens beraubt sind und in Alkohol, Drogen und Kriminalität flüchten, um ihrer maßlosen Frustration zu entfliehen (vgl. Artikel Bätz).
Dass die Entwicklung in diese Richtung geht, ist in den meisten der reichen aber auch der armen Länder unübersehbar. Überall wächst die Kluft zwischen Arm und Reich, was aber nicht heißt, dass diejenigen, die auf der Gewinnerseite stehen, das große Los gezogen haben. Sie bezahlen ihre Rolle als Macher mit Verzicht auf Privatleben, Verlust von humanen Beziehungen, unerträglichem Konkurrenzdruck und ebenfalls mit dem Gefühl, ohnmächtig den gesellschaftlichen Abläufen ausgeliefert zu sein. Selbst als spekulierende Profiteure des Börsenspiels stehen sie immer öfter den Entwicklungen auf den Geldmärkten hilflos gegenüber.
In der Erkenntnis dessen, was auf die Menschheit zukommt, wenn sie sich nicht von ihren traditionellen Denkzwängen und Strukturen befreit, liegt aber auch eine ungeheure Chance,
EIN BLICK AUF DIE GESCHICHTE
Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass die Form, in der Arbeit heute organisiert ist, keinesfalls die einzig mögliche, in der historischen Entwicklung zwar folgerichtig, aber nicht zwangsläufiger Endpunkt der Entwicklung ist. (Auch die von Marxisten behauptete Notwendigkeit, mit der sich die gesellschaftliche Organisation der Arbeit entwickle, ist inzwischen historisch widerlegt. Es sind offensichtlich nicht so sehr außerhalb des Menschen liegende Gesetzmäßigkeiten, sondern menschliche Fähigkeiten und Bedürfnisse, die die gesellschaftliche Entwicklung bestimmen.)
Am Anfang der Menschheitsgeschichte herrschte Subsistenzwirtschaft, d.h. die Menschen versorgten sich gemeinsam jagend oder sammelnd mit dem Lebensnötigen, das sie auch gemeinsam verbrauchten. Überreste dieser Wirtschaftsform ließen sich noch bis ins 20. Jahrhundert bei australischen Ureinwohnern, den Buschleuten Südafrikas und im 19. Jahrhundert bei den Prärieindianern Nordamerikas finden.
Mit der Entdeckung der Viehzucht und des Ackerbaus setzte ein langsamer Prozess der Aufspaltung in Besitzende und Abhängige ein, der mit der Zeit zur Konzentration von Reichtum in den Händen von Land- und Herdeneigentümern führte. Die Abhängigkeit der Besitzlosen fand in den Sklavenhalter-Gesellschaften ihren vorläufigen Höhe- und Endpunkt. Die Zuspitzung des Gegensatzes zwischen Arm und Reich, zwischen völliger Abhängigkeit und Machtlosigkeit und andrerseits despotischer Allmacht leitete den Niedergang dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsform ein. Im Müßiggang erschlafft und antriebslos geworden war die herrschende Klasse Roms im 3. bis 5. Jahrhundert n. Chr. nicht mehr fähig, den Widerstand der Ausgebeuteten militärisch unter Kontrolle zu halten, und wurde von den Goten besiegt und abgelöst. Das feudale Wirtschaftssystem, das an die Stelle des alten trat, konnte sich zunächst die Mitarbeit der abhängigen Bauern sichern, denn diese mussten nur einen geringen Teil des Ertrags abliefern, konnten also durch Steigerung ihrer Arbeitsleistung ihre Lebensverhältnisse verbessern, was den Sklaven auf den Latifundien1) verwehrt war. Außerdem garantierte der Lehnsherr den hörigen Bauern den Schutz vor Übergriffen von außen.
Mit zunehmender Konzentration des Besitzes in den Händen des Adels und der Kirche, wachsenden Abgaben und Frondienstpflichten zur Deckung der Luxusbedürfnisse der herrschenden Schichten und durch deren Machtgier verursachten Kriegskosten, verschärfte sich auch der Gegensatz zwischen Adel und Bauern. Die Bauernkriege des 15. und 16. Jahrhunderts und die Kämpfe zwischen den Städtebürgern und Feudalherren waren erste Hinweise darauf, dass die Feudalordnung den existentiellen Bedürfnissen breiter Schichten des Volkes nicht mehr gerecht werden konnte. Mit der Entstehung des Bürgertums entstand dem Adel ein neuer ernsthafter Konkurrent, sowohl in intellektueller als auch - mit wachsendem Reichtum - in materieller Hinsicht. In England, wo der Adel bereit war, die Macht mit dem Bürgertum zu teilen, vollzog sich ein relativ friedlicher Übergang zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung, während in Ländern wie Frankreich (1789) und viel später auch Deutschland (1918) die alte Oberschicht revolutionär entmachtet wurde, weil sie hartnäckig an autokratischen Strukturen festhielt.
Auch die kommunistischen Systeme, die angetreten waren, die Bedürfnisse
der breiten Massen zu befriedigen, scheiterten wie ihre Vorgänger vor allem an
zwei Dingen: Sie waren unfähig, das Volk an Entscheidungen demokratisch zu
beteiligen und sie konnten das kreative Potential der Werktätigen aufgrund ihrer
Fixierung auf zentrale Planung und Bevormundung nicht zur Entfaltung bringen.
Nach der Selbstauflösung des sozialistischen Lagers tritt nun mit aller Deutlichkeit
ein Hauptwiderspruch global zu Tage, der vorher durch die Spaltung der Welt in
zwei Machtblöcke überdeckt wurde: der Gegensatz zwischen den materiellen
Profiteuren des kapitalistischen Systems und den Milliardenheeren der Verarmten,
[Seite 48] Entrechteten, Mittellosen, um die Früchte ihrer Arbeit Betrogenen, der
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger, der Hungernden und Ausgestoßenen dieses
Systems.
Entrechteten, Mittellosen, um die Früchte ihrer Arbeit Betrogenen, der
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger, der Hungernden und Ausgestoßenen dieses
Systems.
Kriminalität ist eine verbreitete Antwort auf das Gefühl realer Chancenlosigkeit geworden, wobei nicht vergessen werden sollte, dass die individuelle Kleinkriminalität nachweislich weniger als ein Hundertstel des Schadens anrichtet, den korrupte Staatsdiener und Wirtschaftskriminelle verursachen.
Längst haben Wissenschaftler und Vordenker aus den Reihen der Wirtschaft erkannt, dass dieses System schrankenloser Konkurrenz im globalen Maßstab nicht nur den Planeten plündert, der Menschheit die Lebensgrundlagen zerstört und einen riesigen Anteil der Weltbevölkerung zu Almosenempfängern degradiert. Es entzieht auch der Wirtschaft zunehmend die Absatzmärkte und zwingt sie zu immer rücksichtsloserer Konzentration und Monopolisierung, es vernichtet systematisch Arbeitsplätze, indem es Kleinunternehmer ruiniert, und führt zum Ausverkauf der Menschenrechte, indem es nationale Regierungen erpresserisch zur Liquidierung von Arbeitsrechten und zur Streichung von Umweltschutzauflagen zwingt.
Hektisch dirigiert und ausgenutzt wird dieses System von einigen zehntausend Börsenspekulanten, die fiktive Devisenbeträge, die zu 98% nicht mehr durch reale Werte gedeckt sind, durch das Computernetz um den Erdball jagen und auf Kosten der Ärmsten in aller Welt ihre Bankkonten füllen, allerdings immer mit dem Risiko, sich selbst und ganze Märkte zu ruinieren.
LÖSUNGSANSÄTZE
Die Lösungsansätze, die sich aus der beschriebenen Sachlage ergeben, sind bereits heute in erstaunlichem Maße vorhanden und werden in vielen Teilen der Welt schon verwirklicht, ohne allerdings bisher eine tragende Rolle übernommen zu haben. Das Modell der Dorfbanken und Kleinstkredite verschaffte bereits 15 Millionen der Ärmsten die Möglichkeit, sich aus eigener Kraft aus bitterster Armut emporzuarbeiten.
Frauenförderungsprojekte in aller Welt haben begonnen, der benachteiligten Hälfte der Menschheit die Chance einer gleichberechtigten Entwicklung zu geben (Vgl. Tempora Nr.4). Die Forderung nach einer Besteuerung des Devisenhandels ist bereits von UNO-Wirtschaftskommissionen erhoben worden. Pläne für ökologische Wirtschaftsreformen sind weit gediehen und werden in einigen Ländern bereits ansatzweise umgesetzt. So hat Dänemark auf diese Weise den industriellen Energieverbrauch drastisch reduzieren und zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen können. Nach Ansicht von Fachleuten könnten in der BRD durch eine ökologische Umstrukturierung der Wirtschaft mindestens ein Drittel der Energie eingespart und 4 Millionen neue Arbeitsplätze vor allem in der lokalen Kleinindustrie geschaffen werden.
Der Prozess der Umsetzung der AGENDA 21, der auf dem Umweltgipfel 1992 in Rio de Janeiro beschlossen und initiiert wurde, hat in den meisten Ländern der Welt begonnen und in Skandinavien bereits 100% der Kommunen erfasst. In Deutschland gibt es schon 867 Kommunen*), die sich daran beteiligen, in gemeinsamer Arbeit von Bürgern, Verwaltung und Politik eine nachhaltige ökologische und soziale Entwicklung vor Ort auf den Weg zu bringen.
Lösungsansätze, die eine Verteilung und Umgestaltung der Arbeit betreffen, werden ebenfalls bereits erprobt und in diesem Heft dokumentiert. Das Kernproblem, von dessen Bewältigung das Wohl der Menschheit abhängen wird, läßt sich in zwei Punkten bündeln:
Wird es in absehbarer Zukunft gelingen, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Strukturen zu schaffen, die möglichst allen Menschen die Möglichkeit der Beteiligung
an Entscheidungen garantieren, die sie selbst betreffen (Subsidiaritätsprinzip),
[Seite 49] und wird es gelingen, institutionelle Regelungen zu finden, die das
in jedem Menschen vorhandene kreative Potential fördern und zur Anwendung
bringen helfen? Beide Punkte sind unlösbar miteinander verbunden. Denn
Menschen sind nur dort bereit, sich mit ganzem Herzen einzusetzen, wo sie das
Gefühl finden, anerkannt und ernst genommen zu werden, und wo sie ihr eigenes
Schicksal und ihre Lebensbedingungen mitgestalten können.
und wird es gelingen, institutionelle Regelungen zu finden, die das
in jedem Menschen vorhandene kreative Potential fördern und zur Anwendung
bringen helfen? Beide Punkte sind unlösbar miteinander verbunden. Denn
Menschen sind nur dort bereit, sich mit ganzem Herzen einzusetzen, wo sie das
Gefühl finden, anerkannt und ernst genommen zu werden, und wo sie ihr eigenes
Schicksal und ihre Lebensbedingungen mitgestalten können.
Letzten Endes geht es darum, die Würde des Menschen wiederherzustellen, die so viele Jahrtausende mit Füßen getreten wurde. Dies ist nur da möglich, wo der Mensch nicht als hilfloses Opfer, sondern als aktiver Gestalter seines Lebens auftritt. Es setzt aber voraus, dass die hierarchischen Entscheidungs- und Machtstrukturen der Vergangenheit schrittweise einer Beratungskultur Gleichberechtigter Platz machen. Eine Entwicklung, die Reife erfordert, aber vor allem die Entwicklung reifer Persönlichkeiten entscheidend fördern wird. Dies dürfte unsere Selbsterziehungsaufgabe für das nächste Jahrtausend sein. An die Stelle des Prinzips der Unterordnung wird das Prinzip der Kreativität treten, das der ureigensten Bestimmung des Menschen entspricht.
- Roland Greis
- 1) Großgrundbesitz, als Sklavenwirtschaft im alten Rom entstanden
- 2) Stand März 1999
Zitate[Bearbeiten]
- Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht.
- Shakespeare
- Wenn der Mensch keinen Genuss mehr an der Arbeit findet
- und nur arbeitet, um so schnell wie möglich zum Genuss zu gelangen,
- so ist es nur ein Zufall, wenn er kein Verbrecher wird.
- Mommsen
- Warum hat keine Religion vor allem andern das Gebot:
- Du sollst arbeiten?
- Auerbach
- Denke nicht, wenn dir eine höchst schwierige Arbeit bevorsteht, sie übersteige
- des Menschen Kräfte. Wenn etwas möglich und in den Kräften auch nur eines
- einzigen Menschen steht, so sei überzeugt, es ist auch für dich erreichbar.
- Marc Aurel
Ein langer Weg[Bearbeiten]
Dankbarkeit herrschte in jener ersten Zeit als die Menschen was die Natur ihnen gab ernteten. Noch war nichts außer der eigenen Kraft zwischen sie und ihren Schöpfer getreten.
Mit der Vermehrung des Viehs drängte der Fetisch Besitz sich in die Hände der Männer und die sich ihm unterwarfen versklavten die ohne Besitz und Raub begann sich zu lohnen. Seitdem schienen Glück oder Elend nicht mehr abzuhängen vom Zustand der Seele sondern vom Zugang zum Vieh.
Dann begann die Enteignung des Schöpfers: Der Boden wurde Besitz und damit ein neuer Graben der die Menschen trennte gezogen. Das Erbrecht auf Boden teilte die Menschen in Herren und Knechte. Und das Land gerann in Schatullen der Reichen bis nichts mehr zu melken war und die Menschen die man zu Vieh gemacht die alte Ordnung durchstießen.
Das Land wurde neu verteilt und alles begann von vorne diesmal im Namen der Religion bis ein neuer Besitz das Land in den Schatten der Fabrikschlote stellte: Die Lohnsklaverei war erfunden. Zeit materiellen Aufschwungs und menschlichen Niedergangs. Kinderarbeit legalisierter Mord an Seele und Leib eine neue Abart des Besitzstrebens bis man entdeckte dass es besser war für den Frieden im eigenen Lande wenn man das Elend kolonial exportierte. Zeit dafür die Besitzgier auf Kontinente zu richten. Zeit der großen Kriege.
“1917: Ein Land gibt das große Versprechen der Revolution und verrät im nächsten Atemzug alle Hoffnung auf eine bessere Welt. Diesmal nach 70 Jahren schon der Zusammenbruch.
Kurze Frist noch für die Unersättlichen Milliarden verschlingenden Milliardäre Devisenraubritter im Spinnennetz der Geldmärkte. Noch einmal den großen Schnitt durch die Arterien der Menschheit!
Endzeit.
Oder Zeit für einen Anfang in Würde. Ist der Mensch geboren sein eigener Freund oder Vernichter zu sein?
Ist es nicht Zeit zurückzukehren zur Dankbarkeit? Damit der Mensch dem Menschen wird was er sich selbst zu sein von jeher versprochen ist
- Roland Greis
Eine neue Ethik der Arbeit[Bearbeiten]
Arbeit aus Sicht der Bahá’í-Schriften
„Der ist wirklich ein Mensch, der sich heute dem Dienst am ganzen Menschengeschlecht
hingibt.“1), sagt Bahá’u’lláh - nicht gerade ein Satz, der dem Geist unserer Zeit entspricht.
Denn Dienen gilt dem Zeitgenossen als etwas Niedriges, etwas, das unter seiner Würde ist oder
zumindest etwas, das seinen Interessen zuwiderläuft. Das Streben nach dem eigenen Glück,
nicht etwa dem des anderen steht im Vordergrund und bestimmt den Umgang der Menschen
miteinander. Einzelne Gruppen und Völker sind auf ihren jeweiligen Vorteil bedacht, ohne
der ganzen Menschheit Gleiches zuzugestehen.
Arbeit gilt in diesem Zusammenhang als ein notwendiges Übel, das einzige Mittel, auf Dauer einen gewissen Wohlstand zu gewährleisten. Ansonsten scheint sie sinnlos, und ihr einen Sinn zu geben, ist tatsächlich oft schwierig, manchmal kaum möglich. Als sinnvoll empfunden wird allenfalls die Zeit der Muße; das eigentliche Leben beginnt erst nach der Arbeit. Eine solche Einstellung zu dem, was immerhin jahrzehntelang einen wesentlichen Teil unserer Zeit in Anspruch nimmt, ist höchst unbefriedigend.
ÜBER DEN WOHLSTAND
Nun ist nicht etwa der Wohlstand an sich zu verurteilen. 'Abdu'l-Bahá schreibt: „Wohlstand ist allen Lobes wert, wenn er durch die eigenen Anstrengungen eines Menschen und durch die Gnade Gottes auf den Gebieten des Handels, der Landwirtschaft, der Kunst oder des Gewerbefleißes erworben und für menschenfreundliche Zwecke ausgegeben wird.“2) Er mahnt jedoch zur Behutsamkeit: „Eine oberflächliche Zivilisation, die nicht von kultivierter Sittlichkeit getragen wird, ist ein verworrener Mischmasch von Träumen 3), und äußerlicher Glanz ohne inwendige Vollkommenheit ist wie ein Dunst in der Wüste, den der Dürstende für Wasser hält4). Denn eine rein äußerliche Zivilisation kann niemals Ergebnisse zeitigen, die (..) für Frieden und Wohlfahrt der Menschen Gewähr leisten."5)
[Seite 52] Diese beiden Gesichtspunkte, die Bejahung des Wohlstandes auf der einen und die Warnung vor
seiner Überbewertung auf der anderen Seite, fasst 'Abdu'l-Bahá wie folgt zusammen:
„Wenn ein Mensch in seinem Geschäft, in der Kunst oder sonst im Beruf Erfolg hat, so wird er dadurch in die Lage versetzt, sein physisches Wohlergehen zu heben und seinem Körper ein Maß von Annehmlichkeit und Wohlbehagen zu geben, bei dem er sich wohlfühlt. Wir sehen heute rings um uns, wie sich der Mensch mit aller neuzeitlichen Bequemlichkeit und Pracht umgibt und seiner physischen, materiellen Seite nichts versagt. Doch seid auf der Hut, dass ihr über der allzu starken Beachtung des Leiblichen nicht die Bedürfnisse der Seele hintanstellt(...) Gewiss ist materieller Fortschritt gut und lobenswert, doch sollen wir darüber nicht den wichtigeren geistigen Fortschritt außer acht lassen (..) Nur durch geistiges und materielles Wachsen können wir wirklichen Fortschritt erreichen und vollkommene Wesen werden.“6)
Diese beiden Gesichtspunkte, die Bejahung des Wohlstandes auf der einen und die Warnung vor
seiner Überbewertung auf der anderen Seite, fasst 'Abdu'l-Bahá wie folgt zusammen:
„Wenn ein Mensch in seinem Geschäft, in der Kunst oder sonst im Beruf Erfolg hat, so wird er dadurch in die Lage versetzt, sein physisches Wohlergehen zu heben und seinem Körper ein Maß von Annehmlichkeit und Wohlbehagen zu geben, bei dem er sich wohlfühlt. Wir sehen heute rings um uns, wie sich der Mensch mit aller neuzeitlichen Bequemlichkeit und Pracht umgibt und seiner physischen, materiellen Seite nichts versagt. Doch seid auf der Hut, dass ihr über der allzu starken Beachtung des Leiblichen nicht die Bedürfnisse der Seele hintanstellt(...) Gewiss ist materieller Fortschritt gut und lobenswert, doch sollen wir darüber nicht den wichtigeren geistigen Fortschritt außer acht lassen (..) Nur durch geistiges und materielles Wachsen können wir wirklichen Fortschritt erreichen und vollkommene Wesen werden.“6)
ÜBER DIE MUßE
Dem Bemühen um materiellen und geistigen Fortschritt steht die Muße, obgleich es zunächst so scheinen mag, nicht unbedingt entgegen. 'Abdu'l-Bahá erwähnt einen Gläubigen, der sie in besonderer Weise zu würdigen wusste: „Er verbrachte seine Tage in höchster Seligkeit. Er führte ein kleines Geschäft, das ihn vom Morgen bis zum Mittag in Anspruch nahm. An den Nachmittagen pflegte er seinen Samowar zu nehmen und ihn in einen dunkelfarbenen, aus einer Satteltasche gefertigten Sack zu stecken. Dann ging er in einen Garten, auf eine Wiese oder hinaus auf ein Feld, um dort seinen Tee zu trinken (..) Muhammad-‘Alí pflegte jede Segnung, die ihm zuteil wurde, sorgsam zu würdigen. ‚Wie köstlich ist mein Tee heute‘, bemerkte er, ‚welch ein Aroma, welch eine Farbe! Wie lieblich ist diese Wiese, und wie leuchten ihre Blumen!' Er pflegte zu sagen, dass alles, selbst die Luft und das Wasser, einen eigenen besonderen Duft habe. Für ihn vergingen die Tage in unbeschreiblicher Freude. Selbst Könige seien nicht so glücklich wie dieser alte Mann, sagten die Leute.“7) 'Abdu'l-Bahá warnt allerdings auch vor Übertreibungen: „Es besteht die Gefahr, dass Kurzweil ausartet in Zeitvergeudung. Zeitvergeudung ist jedoch in der Sache Gottes nicht zulässig.“ 8) Dass Muße nicht sich selbst genügen, sondern zu etwas anderem dienen soll, wird aus der folgenden Äußerung 'Abdu'l-Bahá's deutlich: „Wenn ein Mensch schläft, sollte es nicht zum Vergnügen sein, sondern um den Körper auszuruhen, um besser handeln, besser sprechen, schöner erklären, den Dienern Gottes dienen und die Wahrheiten beweisen zu können.“9)
ARBEIT ALS PFLICHT
Welche Haltung sollten wir nun unserer Arbeit gegenüber einnehmen? Zuallererst ist sie eine Pflicht, eine Notwendigkeit für den einzelnen, der ein angenehmes und vor allem sinnvolles Leben führen will, und eine Notwendigkeit für die Gesellschaft, die das Wohlergehen ihrer Glieder sichern und die Entwicklung einer Kultur ermöglichen soll. Bahá’u’lláh schreibt: „O Meine Diener! Ihr seid die Bäume Meines Gartens. Ihr müßt gute und köstliche Früchte tragen, damit sie euch und anderen nützen. Darum ist es jedermanns Pflicht, sich einem Handwerk oder Beruf zu widmen, denn darin liegt das Geheimnis des Wohlstands, o ihr Einsichtigen! Denn der Erfolg hängt von den Mitteln ab, und die Gnade Gottes sollte für euch allgenügend sein. Fruchtlose Bäume waren immer fürs Feuer bestimmt und werden es bleiben.“ 10) Streng werden diejenigen getadelt, die ihrer Pflicht nicht nachkommen: „Vergeudet eure Zeit nicht mit Faulheit und Müßiggang. Beschäftigt euch mit dem, was euch und anderen nützt(...) Die verächtlichsten Menschen in den Augen Gottes sind die, welche faul dasitzen und betteln. Haltet euch fest an das Seil der weltlichen Mittel, im vollen Vertrauen auf Gott, der euch mit allen Gütern versorgt.“11) Ebenso deutlich ist die Absage an diejenigen, die in der Weltflucht ein Zeichen besonderer Gottergebenheit sehen: „O Volk der Erde! Einsiedelei und Askese sind in Gottes Gegenwart nicht annehmbar. Den Einsichtigen und Verständigen frommt die Beobachtung dessen, was strahlende Freude bewirkt. Bräuche, aus eitlem Wahn gezeugt oder aus dem Schoß des Aberglaubens geboren, stehen dem Wissenden übel an.“ 12)
Uns ist vielmehr die Verantwortung auferlegt, Möglichkeiten anzunehmen, Fähigkeiten nicht zu vernachlässigen und in jeder Hinsicht nach Vollkommenheit zu streben. Bahá’u’lláh betont dies nachdrücklich: „Der Mensch ist der höchste Talisman. Der Mangel an geeigneter Erziehung hat ihn jedoch dessen beraubt, was er seinem Wesen nach besitzt. (..) Betrachte den Menschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.“13)
ARBEIT ALS GOTTESDIENST
Es geht also um mehr als die bloße Erfüllung einer Pflicht. Arbeit ist - recht verstanden - Ausdruck
der Hingabe des Geschöpfes an seinen Schöpfer. Bahá’u’lláh deutet darauf mit den folgenden Worten hin:
„O Meine Diener! Die besten unter den Menschen sind jene, die durch einen Beruf ihren Lebensunterhalt verdienen und ihn für sich und
[Seite 53] ihre Angehörigen verwenden, in der Liebe zu Gott, dem Herrn aller Welten.“14)
ihre Angehörigen verwenden, in der Liebe zu Gott, dem Herrn aller Welten.“14)
Damit beginnt verständlich zu werden, welchen Wert Er der Arbeit beimisst. „Jedem von euch ist es zur Pflicht gemacht, sich in einem Beruf - einem Handwerk, Gewerbe und dergleichen - zu betätigen. Wir haben eure Tätigkeit bei solcher Arbeit gnädiglich zum Rang des Dienstes an Gott, dem Wahren, erhoben. Denkt in euren Herzen über die Gnade und den Segen Gottes nach und sagt Ihm Dank des Abends und des Morgens(...) Wer sich in einem Handwerk oder Gewerbe betätigt, dessen Tätigkeit wird von Gott als Gottesdienst gewertet; und dies ist nur ein Zeichen Seiner unendlichen, alles durchdringenden Großmut.“ 15)
Diese Äußerung mag zunächst befremdlich erscheinen. Gottesdienst bedeutet heute meist kultische Handlung, feierliche Liturgie. Aber was eigentlich ist Gottesdienst? 'Abdu'l-Bahá sagt: „Ich wünsche daher, dass(..) eure Absichten rein und aufrichtig seien, dass euer Streben dem Dienste am Mitmenschen ohne Rücksicht auf euer persönliches Wohlergehen gelten möge, ja, dass all euer Trachten auf das Wohlergehen der Menschheit gerichtet sei(..)“16)
Er macht deutlich, dass weniger wichtig ist, was wir tun, als vielmehr, wie wir es tun. „Im Bahá’í-Glauben werden Künste, Wissenschaften und alle Arbeit als Gottesdienst erachtet. Ein Mensch, der etwas, sei es auch nur ein Stück Notizpapier, nach seinem besten Können herstellt und dabei bewusst alle seine Kräfte darauf richtet, es zu vervollkommnen, preist damit Gott. Kurz, alle Bemühungen und Anstrengungen, die der Mensch macht, sofern sie von ganzem Herzen kommen und er von den höchsten Beweggründen und dem Willen dazu getrieben wird, der Menschheit zu dienen, sind Gottesdienst. Gott dienen heißt, der Menschheit dienen und den Nöten der Menschen abhelfen. Dienst ist Gebet. Ein Arzt, der dem Kranken frei von Vorurteilen, freundlich und sorgsam hilft und an die Zusammengehörigkeit der Menschheit glaubt, preist damit Gott.“17)
FOLGERUNGEN FÜR DEN EINZELNEN
Der Wert einer Arbeit ist also nicht daran zu messen, ob sie mit den Händen oder mit dem Kopf getan wird. Wer zum Wohle anderer arbeitet, verdient deren Achtung - und seine eigene. 'Abdu'l-Bahá schreibt: „In dieser allumfassenden Sendung wird das wundersame handwerkliche Können des Menschen als Dienst an der Strahlenden Schönheit angesehen. Bedenke, welch eine Gnade und welch ein Segen es ist, dass Handwerk als Gottesdienst betrachtet wird. (...) Es geziemt den Handwerkern der Welt, (...) sich aufs äußerste zu mühen, mit Fleiß ihrem Beruf nachzugehen, so dass ihr Streben hervorbringe, was die größte Schönheit und Vollkommenheit vor aller Menschen Augen offenbaren wird.“ 18)
Vielleicht wird die Verbindung von materiellem und geistigem Fortschritt nirgends so deutlich wie im Bereich der Arbeit. Dass gerade hier menschliche Entfaltung in beiderlei Hinsicht möglich ist, hebt Bahá’u’lláh ausdrücklich hervor. „Künste, Handwerke und Wissenschaften erhöhen die Welt des Seins und tragen zu ihrer Vervollkommnung bei. Wissen gleicht den Flügeln für des Menschen Leben, einer Leiter für seinen Aufstieg. Es ist jedermanns Pflicht, sich Wissen zu erwerben, jedoch sollten solche Wissenschaften studiert werden, die den Völkern auf Erden nützen, nicht solche, die mit Worten beginnen und mit Worten enden. Viel verdanken fürwahr die Völker der Welt den Wissenschaftlern und den Handwerkern. Dies bezeugt das Mutterbuch am Tage Seiner Wiederkehr. Glücklich ist, wer hörende Ohren besitzt. In der Tat, Wissen ist ein wahrer Schatz für den Menschen, eine Quelle des Ruhmes, der Großmut, der Freude, der Erhabenheit, des Frohsinns und der Heiterkeit.“ 19)
Selbst scheinbar nutzlose, lästige oder eintönige Tätigkeiten bleiben nicht länger notwendige Übel, sondern erhalten ihren Sinn als Teile eines Ganzen. Sie können beitragen zu der Zufriedenheit, die Bahá’u’lláh jedem Menschen wünscht: „Einen Beruf auszuüben, ist sehr empfehlenswert; denn wenn man arbeitet, ist man weniger geneigt, sich bei den unangenehmen Seiten des Lebens aufzuhalten. So Gott will, wirst du in jeder Stadt und jedem Land wo du auch weilst, strahlende Freude, Frohsinn und Frohlocken erfahren.“ 20)
FOLGERUNGEN FÜR DIE GESELLSCHAFT
Heute scheint es oft unmöglich, Arbeit als Gottesdienst zu verstehen. Jede Kultur erfordert ein gewisses Maß an Arbeitsteilung, und die Entwicklung ist in dieser Hinsicht sehr weit fortgeschritten. Ihren unangenehmen Folgen entgegenzuwirken, ist, wie Shoghi Effendi andeutet, nicht nur eine Sache des einzelnen. „Es ist die Pflicht der für die Ordnung der Gesellschaft Verantwortlichen, einem jeden die Gelegenheit zu geben, sich die für einen Beruf notwendigen Fähigkeiten anzueignen wie auch die Mittel, diese Fähigkeiten zu nützen - sowohl um ihrer selbst willen als auch, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.“ 21)
Auch die wirtschaftliche Lage der Arbeitenden ist in diesem Zusammenhang keineswegs ohne
Bedeutung. Ein Hinweis darauf findet sich in der folgenden Äußerung 'Abdu'l-Bahás:
„Die Frage der Vergesellschaftung ist sehr wichtig(...). Zum Beispiel sollten die Eigentümer von Ländereien, Bergwerken und Fabriken ihre Einkünfte mit ihren Arbeitnehmern teilen und einen gerechten, festen
[Seite 54] Prozentsatz des Erwirtschafteten an die Werktätigen geben, damit die Arbeitnehmer außer ihrem Lohn etwas von dem allgemeinen Einkommen der Fabrik erhalten, so dass sie sich bei ihrer Arbeit von ganzem Herzen bemühen.“22)
Prozentsatz des Erwirtschafteten an die Werktätigen geben, damit die Arbeitnehmer außer ihrem Lohn etwas von dem allgemeinen Einkommen der Fabrik erhalten, so dass sie sich bei ihrer Arbeit von ganzem Herzen bemühen.“22)
Shoghi Effendi betont allerdings, dass Bahá’u’lláh nicht auf alle Einzelheiten einer künftigen Wirtschaftsordnung eingegangen ist. „Das Wichtigste ist der Geist, der unser Wirtschaftsleben durchdringen muss, und dieser wird allmählich zu bestimmten Institutionen und Prinzipien kristallisieren, die dazu beitragen werden, den von Bahá’u’lláh vorausgesagten idealen Zustand herbeizuführen.“21)
- Dieser Text ist eine leicht gekürzte Neufassung eines im Bahä'i-Verlag veröffentlichten Aufsatzes.
- Friedo Zölzer
Quellen:
1) Bahá’u’lláh in: Ährenlese aus den Schriften Bahá’u’lláhs, 3. revidierte Auflage, Hofheim Langenhain 1980, 117
2) 'Abdu'l-Bahá: Das Geheimnis göttlicher Kultur, Oberkalbach 1973, S.31
3) Qurán 24:39
4) Qur'án 12:44,21:5
5) 'Abdu'l-Bahá; Das Geheimnis göttlicher Kultur, a.a.O., S.60
6) 'Abdu'l-Bahá: Ansprachen in Paris, 5. Auflage, Frankfurt 1963, S.46
7) 'Abdu'l-Bahá: Memorials of the Faithful, Wilmette Illinois 1971, S.25
8) 'Abdu'l-Bahá in: J.E.Esslemont: Bahá’u’lláh und das neue Zeitalter, 6. Auflage, Hofheim-Langenhain 1976, S.123
9) 'Abdu'l-Bahá in: Leben als Bahá’í, Oberkalbach 1973, S.19
10) Bahá’u’lláh: Verborgene Worte, Frankfurt 1965, persisch 80
11) Bahá’u’lláh: Botschaften aus 'Akká, Bishárát 3:22,23, Hofheim-Langenhain 1982
12) Bahá’u’lláh: Botschaften aus 'Akká, Kalimát-i-Firdawsiyyih 6:37, a.a.O.
13) Bahá’u’lláh in: Ährenlese aus den Schriften Bahá’u’lláhs, a.a.O., 122
14) Bahá’u’lláh: Verborgene Worte, a.a.O., persisch 82
15) Bahá’u’lláh: Botschaften aus 'Akká, Bishárát 3:22, 23, a.a.O.
16) 'Abdu'l-Bahá in: Göttliche Lebenskunst, Oberkalbach 1971, S.66
17) 'Abdu'l-Bahá in: J.E. Esslemont: Bahá’u’lláh und das neue Zeitalter, a.a.O., S.99
18) 'Abdu'l-Bahá in: Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá, Haifa 1978, S.145
19) Bahá’u’lláh: Botschaften aus 'Akká, Tajalliyát 5:15, a.a.O., und Brief an den Sohn des Wolfes, Frankfurt 1966, S.38
20) Bahá’u’lláh: Botschaften aus 'Akká, Lawh-i-Maqsúd 11:42, a.a.O.
21) Shoghi Effendi in: Directives from the Guardian, New Delhi 1973, 218
22) 'Abdu'l-Bahá in: Foundations of World Unity, Wilmette Illinois 1971, S.43
23) Shoghi Effendi in: Directives from the Guardian, a.a.O., 55
DIE BAHÁ'Í-RELIGION
ZENTRALE LEHREN
- Die Einheit Gottes
- Es gibt nur einen Gott, mit welchem Namen er
- auch benannt oder umschrieben wird.
- Die Einheit der Religionen
- Alle Offenbarungsreligionen bergen den gleichen
- Kern ewiger Wahrheiten, wie die Liebe zu Gott und
- den Menschen.
- Bestimmte Gesetze jedoch, die z.B. die Organisation
- der Gemeinde, das Sozialwesen, Hygiene etc. betreffen,
- müssen sich im Zuge der Menschheitsentwicklung
- verändern. In großen Zyklen offenbart Gott
- sich durch seine Boten wie Moses, Krishna, Buddha,
- Christus, Mohammed und Bahá’u’lláh und erneuert
- diesen Teil seiner Gebote als Antrieb für den
- menschlichen Fortschritt.
- Die Einheit der Menschheit
- Die Menschheit ist eine einzige, große Familie mit
- völlig gleichberechtigten Mitgliedern.
- Ihren Ausdruck finden diese grundlegenden Lehren
- in Prinzipien wie:
- ▪ Selbständige Suche nach Wahrheit
- ▪ Gleichwertigkeit von Frau und Mann
- ▪ Soziale Gerechtigkeit
- ▪ Entscheidungsfindung durch Beratung
- ▪ Abbau von Vorurteilen.
- ▪ Übereinstimmung von Religion und Wissenschaft
ZENTRALE GESTALTEN
- Báb (1819-1850), der Vorbote
- Bahá’u’lláh (1817-1892), der Stifter
- 'Abdu'l-Bahá (1844-1921), der Ausleger
- Shoghi Effendi (1897-1957), der Hüter
DIE BAHÁ'Í-GEMEINDE
- organisiert sich in Gremien, die auf örtlicher, nationaler und internationaler Ebene
- von allen erwachsenen Gemeindemitgliedern in freier, gleicher und geheimer Wahl
- ohne Kandidatur oder Wahlkampagnen gewählt werden. Es gibt keine Priester.
- Europäisches Bahá’í-Haus der Andacht in Hofheim-Langenhain/ Deutschland
- Die nächste Ausgabe
- TEMPORA
- Nr. 5
- AGENDA 21


























