Tempora/Nummer 12/Text
TEMPORA
Nr. 12
Familie
NR. 12 INHALT
Keimzelle Familie . . . . . 4
- Roland Greis
Unternehmen Zukunft . . . . . 8
- Gedicht
Ohne Familie keine Gesellschaft . . . . . 9
- Die Bedeutung der Familie
- Hilde Schillert
Not macht erfinderisch und offen für neue Ideen . . . . . 12
- Ein Bericht aus dem Jahr 2030
- Thomas Schaaff
Kein Märchen - eine glückliche Kindheit . . . . . 15
- Lorcan Flynn
Positive Emotlonen sind die Motoren des Lebens . . . . . 18
- Vom Umgang mit „schwierigen” Kindern
- Monigue Forest-Lindemann
Die ersten Jahre sind die wichtigsten . . . . . 23
- Prägung Im Kindesalter
- Mina Weiser
Kinder wollen und können früh Verantwortung übernehmen . . . . . 26
- Rechte und Pflichten von Kindern in der Familie
- Karen Reitz-Koncebovski
Traditionelle Weisheiten, progressive Prinzipien und praktische Instrumente . . . . . 30
- Ansätze zu einem positiven Familienkonzept für das 21. Jahrhundert
- Hamid Peseschkian
Alkohol und die Folgen . . . . . 36
- Roland Greis
Familie im Wandel . . . . . 38
- Aufbruch in eine neue Dimension der Beziehungsqualität
- Daniela und Walter E. Fritzsche
Keuschheit - oder die Wiederentdeckung eines Wortes . . . . . 42
- Thomas Schaaff
Familie der Zukunft - Zukunft der Familie . . . . . 46
- Familie im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gleichberechtigung
- Katrin Modabber
EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
jeder Mensch hat Familie - ob er will oder nicht. Ob er in ihr und mit ihr glücklich wird, wie sie ihn prägt und wie er mit dieser Prägung sein Leben gestaltet, hängt von der Sozialisation ab, die er in eben dieser seiner Familie erlebt. Hier lernt er, mit anderen Menschen zusammenzuleben, hier gewinnt er die emotionale Sicherheit, die für seine Entwicklung nötig ist, hier verinnerlicht er die Maßstäbe, nach denen er sein Leben gestalten wird - ob im Guten oder im Schlechten. Obwohl es derzeit scheint, als ob die Familie zerfällt, sich immer weniger Leute trauen und immer mehr scheiden lassen, immer weniger Kinder geboren werden: Die Familie steht bei jungen Menschen als Lebensziel immer noch ganz oben. Aber wie können sie diese Aufgabe meistern in einer Welt, der die Maßstäbe immer mehr abhanden kommen, in der es immer weniger Vorbilder dafür gibt, wie eine Familie erfolgreich sein kann?
Die alten Rollenbilder haben ausgedient, und im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gleichberechtigung suchen die Menschen nach Modellen, wie sie diesen Wandel aktiv und positiv mitgestalten können. Dafür gibt es bereits Konzepte. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass sich eine religiöse Orientierung günstig auf das Familienleben auswirkt. Das passt zu den Aussagen in allen Religionen, welche die Bedeutung der Familie für die Entwicklung des Menschen bestätigen: Es gibt keine Alternative
In der Ihnen vorliegenden neuen TEMPORA-Ausgabe haben wir uns dem Thema von unterschiedlichsten Standpunkten aus genähert, wohl wissend, dass es unzählige andere gibt. Dennoch wünschen wir uns, dass jede Leserin und jeder Leser Anregungen für die Weiterentwicklung seiner Familie oder für seine Vorstellungen von Familie findet, denn ohne Familie hat die Gesellschaft keinen Bestand
- Die Redaktion
Keimzelle Familie[Bearbeiten]
Schuldzuweisungen sind eine beliebte Methode, Verantwortung auf andere abzuwälzen.
In der Diskussion um die zunehmenden gesellschaftlichen Missstände werden sie häufig geübt, mit dem Ergebnis, dass alles bleibt, wie es ist. Dies wird dadurch garantiert, dass jeder von jeweils anderen Veränderung erwartet. Im Erziehungsbereich sorgt diese Haltung seit Jahrzehnten für Stagnation. Denn wer Veränderungsbedarf nur außerhalb seiner selbst sieht, verurteilt sich zur Hilflosigkeit. Wenn Eltern erwarten, dass die Schule ihre Kinder erzieht, Lehrer die Eltern für alle Probleme verantwortlich machen und politisch Verantwortliche versuchen, durch Kürzung der Bildungsetats der Misere Einhalt zu gebieten und Finanzierungsverantwortung an die Betroffenen delegieren, ohne Entscheidungsspielräume für diese zu öffnen, ist es nicht verwunderlich, dass die Probleme zunehmen.
- Am Anfang ist familiäre Erziehung
Vom Kind aus betrachtet ist die Familie der Anfang von allem. Die Art, wie Kinder in ihrer oder immer häufiger außerhalb ihrer Familie aufwachsen, wird allerdings wesentlich von der Bildungs- und Kulturpolitik beeinflusst und von den in der Gesellschaft herrschenden Vorstellungen und Gewohnheiten. Dennoch ist es sinnvoll, die Bedeutung familiärer Einflüsse zu untersuchen und das Ausmaß elterlicher Verantwortung auszuloten.
Denn Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzieher. Ihr Verständnis oder Unverständnis, ihre Fähigkeiten oder Unfähigkeiten prägen entscheidend den Lebensweg ihrer Kinder. Erst wenn der Einzelne und die Gesellschaft das Ausmaß dieser Verantwortung erkennen, kann sie auch angemessen wahrgenommen werden.
Die Entwicklungspsychologie hat in den vergangenen Jahren die überragende Bedeutung der ersten vier bis fünf Jahre für die Entwicklung eines Kindes nachgewiesen. Das ist die Zeit, in der Kinder entsprechend den Anregungen und Einflüssen, denen sie ausgesetzt sind, ihre grundlegenden Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Überzeugungen und Wertvorstellungen entwickeln. Die charakterlichen Eigenarten, die in diesen entscheidenden Jahren erworben werden, sind später nur sehr mühsam veränderbar und werden oft auch dann beibehalten, wenn sie sich als wenig konstruktiv erweisen. Das soll an einem besonders wichtigen Beispiel erläutert werden.
- Vertrauen und Selbstvertrauen
Das vertrauen der Eltern in das Entwicklungspotenzial ihres Kindes hat einen enormen Einfluss darauf, wie stark sich dessen Selbstvertrauen und Fähigkeiten entfalten können.
Eltern, die ihrem Kind wenig zutrauen, die ständig eingreifen, den Erfahrungsspielraum ihres
Kindes unnötig einschränken, es entmutigen und auch in gefahrlosen Situationen seinen
Forscherdrang bremsen, tragen wesentlich dazu bei, bei ihrem Kind Passivität, Hilflosigkeit,
Versagensängste und Misserfolge zu erzeugen. Solche Kinder haben Schwierigkeiten, sich auf
unbekannte Situationen einzustellen, sie sind aufgrund fehlenden Selbstvertrauens beim
Erwerb neuer Fähigkeiten stark behindert und entwickeln häufig ein Selbstbild, das ihre
Probleme noch verstärkt: Sie sind überzeugt, wenig erreichen zu können und hindern sich
dadurch systematisch daran, erfolgreich zu werden. Zu einer realistischen Selbsteinschätzung
sind solche Menschen oft ihr Leben lang nicht fähig, weil sie nie das Glücksgefühl erfahren
haben, das sich einstellt, wenn man nach ausdauernder und intelligenter Bemühung ein Ziel
aus eigener Kraft erreicht hat. So erzeugt frühzeitige Entmutigung oft lebenslange Mut- und
Hilflosigkeit. Verstärkt wird das noch, wenn Eltern aus vermeintlich guter Absicht ihren
Kindern einreden, sie seien für bestimmte Tätigkeiten unbegabt, was häufig mit Vererbung
[Seite 5] begründet wird. Damit entfällt für das Kind jeder weitere Grund zur Bemühung, denn niemand
wird sich an einer Sache versuchen, die für aussichtslos gehalten wird.
begründet wird. Damit entfällt für das Kind jeder weitere Grund zur Bemühung, denn niemand
wird sich an einer Sache versuchen, die für aussichtslos gehalten wird.
Je früher und häufiger ein bestimmtes Verhalten eingeübt wird, desto stärker und nachhaltiger verfestigt es sich schließlich zu einer Überzeugung. Das lässt sich natürlich auch positiv nutzen. Indem man Kindern möglichst viele Möglichkeiten bietet, ihrem angeborenen Forscherdrang nachzugehen, ihnen Mut macht, Neues zu erproben und Probleme so weites geht allein zu lösen, sich neue Fähigkeiten anzueignen, gibt man ihnen das vermutlich wertvollste mit auf den Weg, das ein Mensch besitzen kann: Selbstsicherheit.
Es ist leicht einzusehen, dass Kinder, die in der Überzeugung heranwachsen, dass sie Dinge, die sie wirklich wollen, auch erreichen können, ganz andere Voraussetzungen für ein zufriedenes und sinnvolles Leben haben als solche, die vor jedem Problem Versagensängste entwickeln.
- Soziales Lernen und erzieherische Kompetenz
Familien sind aber auch der Ort, an dem Kinder lernen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und Konflikte zu lösen - oder auch nicht. Soziales Lernen setzt eine gewisse Kontinuität in der Bezugsgruppe voraus. Keine andere Institution ist dafür geeigneter als die Familie. Wieweit ein Kind lernt, friedlich und konstruktiv mit seinen Mitmenschen umzugehen, hängt von den erzieherischen Fähigkeiten der Bezugspersonen ab. Leider ist Erziehung eines der wenigen Gebiete, auf dem man Verantwortung übernehmen kann, ohne Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben. Für die banalsten Tätigkeiten benötigt man bei uns einen Fähigkeitsnachweis. An der vermutlich verantwortungsvollsten aller Aufgaben, der Erziehung künftiger Generationen, kann jeder Dilettant sich zum Schaden seiner Nachfahren versuchen, ohne die geringste Kenntnis zu haben. Das Ergebnis ist, dass mangels Einsicht in die Zusammenhänge die Fehler vergangener Generationen wiederholt werden.
Die Schule wäre der geeignete Ort, um flächendeckend pädagogische Grundkompetenzen zu vermitteln und künftige Eltern auf ihre Verantwortung vorzubereiten, aber bestenfalls Oberstufenschüler haben in Deutschland die Möglichkeit, Pädagogik zu wählen. Gerade diejenigen, die es besonders nötig hätten, weil ihre eigene Erziehung ihnen nur wenige Entwicklungschancen geboten hat, bleiben davon ausgeschlossen. Das wäre aber eine großartige Möglichkeit, ihnen gerade auf einem Gebiet, auf dem sie leidvolle Erfahrungen gemacht haben, Kenntnisse, konstruktive Handlungsperspektiven und damit Auswege aus der eigenen Misere zu vermitteln und ein entscheidender Schritt, um soziale Aufstiegschancen zu verbessern.
Sinnvoll wäre es, wenn werdende Eltern zusätzlich als vorgeburtliche Maßnahme die wichtigsten Grundregeln einer sinnvollen Erziehung vermittelt bekämen wie das zum Beispiel in Finnland geschieht. Bisher nehmen Eltern psychologische Beratung erst in Anspruch, wenn das Kind bereits Verhaltensstörungen zeigt. Viel effektiver und langfristig kostengünstiger für die Gesellschaft wäre flächendeckende Vorbeugung.
- Kooperation statt Bevormundung
Zunehmende Gewalt in Familien und Schulen, die steigende Zahl der Gewaltdelikte: Das sind Symptome einer Hilflosigkeit, teilweise einer ohnmächtigen Wut, deren Ursachen meist sehr früh gelegt werden. Menschen, die nie lernen durften, dass Konflikte zum Anlass gemeinsamen Wachstums werden können, die in ihren Familien, der schule, den Medien ständig mit Druck, Gewalt und Missachtung der Menschenwürde konfrontiert werden, entwickeln fast zwangsläufig persönliche Überlebensstrategien, die wenig sozialverträglich sind. Wer in der Familie nicht lernt, seine persönlichen Bedürfnisse mit denen der Gemeinschaft zu harmonisieren, wer häufig Verletzung seiner elementaren Rechte erfährt, wird Überzeugungen und Verhaltensweisen entwickeln, die entweder in die Depression oder in eine aggressive Durchsetzung der eigenen Wünsche führen.
Eine gesunde Entwicklung setzt voraus, dass Kinder ernst genommen werden. Wenn sie das Gefühl
bekommen, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse geachtet werden, wenn sie ihren wachsenden
[Seite 6] Fähigkeiten entsprechend etwas bewirken und positive Beiträge zum Familienleben machen
dürfen, entwickeln sie ganz natürlich Verantwortungsgefühl. Ihr Wunsch nach Zugehörigkeit
lässt sie gern Pflichten übernehmen, sofern deren Erledigung anerkannt und geschätzt wird.
Wenn Aufgaben zunächst im Geiste gemeinsamer Bemühung und gegenseitiger Unterstützung
erledigt werden, erwacht von selbst das Bedürfnis nach mehr Selbstständigkeit und zunehmender
Arbeitsteilung. Denn das entspringt dem elementaren Bedürfnis, unsere Kräfte zu erproben. Die
Erfahrung positiver Macht, das heißt, etwas für sich und andere machen zu können und dadurch
ein geachteter Teil des Ganzen zu werden, schafft inneren und äußeren Frieden und ist das
beste Heilmittel gegen Egoismus und Rücksichtslosigkeit.
Fähigkeiten entsprechend etwas bewirken und positive Beiträge zum Familienleben machen
dürfen, entwickeln sie ganz natürlich Verantwortungsgefühl. Ihr Wunsch nach Zugehörigkeit
lässt sie gern Pflichten übernehmen, sofern deren Erledigung anerkannt und geschätzt wird.
Wenn Aufgaben zunächst im Geiste gemeinsamer Bemühung und gegenseitiger Unterstützung
erledigt werden, erwacht von selbst das Bedürfnis nach mehr Selbstständigkeit und zunehmender
Arbeitsteilung. Denn das entspringt dem elementaren Bedürfnis, unsere Kräfte zu erproben. Die
Erfahrung positiver Macht, das heißt, etwas für sich und andere machen zu können und dadurch
ein geachteter Teil des Ganzen zu werden, schafft inneren und äußeren Frieden und ist das
beste Heilmittel gegen Egoismus und Rücksichtslosigkeit.
- Familien als Wertevermittler
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung ein Gefühl der Sicherheit, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, vermittelt durch das Verhalten ihrer Erzieher. Wenn Regeln nicht für alle gelten oder ohne einsichtige Gründe außer Kraft gesetzt werden, wenn in der Familie ein Machtgefälle besteht, das einige zu Entscheidern und andere zu Befehlsempfängern macht, lernen die Kinder nicht dauerhaft zu kooperieren. Mit wachsendem Alter entwickeln sie Widerstand gegen die ungerecht ausgeübte Macht. Sie gewinnen die Überzeugung, dass sie ihrerseits ihre Rechte nur mit den Mitteln des Machtkampfes durchsetzen können. Das ursprünglich konstruktive Bedürfnis, etwas bewirken zu können, degradiert zum egoistischen Durchsetzungswillen. Ziel ist es dann nicht mehr, seinen Platz in einem harmonischen Organismus zu finden, sondern im rücksichtslosen Durchsetzen persönlicher Interessen die eigene Position zu verbessern.
Verbindliche, von allen verstandene und anerkannte Werte und Grundsätze helfen, dieses Dilemma zu vermeiden. Aufgabe der Eltern ist es zunächst, den Sinn dieser Leitprinzipien begreifbar zu machen. Sobald die Kinder aber in der Lage sind, ihre eigenen Vorstellungen zu artikulieren, ist die Zeit für gemeinsame Beratungen gekommen.
- Gleichwertigkeit
Das oberste Prinzip, von dem das langfristige Gelingen der Bemühungen abhängt, ist das der Gleichwertigkeit. Nur wenn Kinder sich und ihre Bedürfnisse ernst genommen, das heisst als gleichwertig behandelt fühlen, werden sie langfristig bereit sein, ihre Fähigkeiten und Kräfte positiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Für Eltern ist dies nicht immer einfach, denn sie schleppen oft noch einen Ballast an veralteten, aus hierarchischen Verhältnissen stammenden Vorstellungen mit und projizieren diese unreflektiert auf ihre Kinder. Wer selbst als Kind nicht gleichwertig behandelt wurde, hat es oft schwer, dies seinen Kindern zu ersparen.
Dabei hilft es, sich zu fragen, ob man Kinder in die Welt gesetzt hat, um sie die eigenen Leiden wiederholen zu lassen, ob man die daraus resultierenden Kämpfe und entwürdigenden Situationen neu inszenieren will. Als regelmäßige Übung ist der Versuch, sich in die Rolle des anderen zu versetzen, sehr hilfreich. Wenn wir uns vorstellen, wie das, was wir tun, auf uns wirken würde, fällt es schwerer, ungerecht oder achtlos zu sein. Anstatt reflexartig zu reagieren sollten wir zunächst genau beobachten, Motive zu verstehen versuchen und nachfragen, was hinter einem bestimmten Wunsch oder Verhalten steckt.
Auf diese Weise geben wir Kindern das Gefühl, als Partner ernst genommen zu werden und fördern dadurch ihre Kooperationsbereitschaft.
- Grenzen setzen lernen
Eltern und Erziehern bleibt natürlich nicht erspart, zwischen berechtigten und unberechtigten
kindlichen Wünschen zu unterscheiden und im zweiten Fall Grenzen zu setzen. Da Kinder mit einem
starken Forscherdrang auf die Welt kommen, müssen sie ständig ausprobieren, was möglich ist und
was nicht. Das ist für Erzieher eine ständige Herausforderung. Denn sie müssen herausfinden, was
das Kind mit seinem Handeln bezweckt und erkennen, ob und inwieweit dies mit den Erfordernissen
eines gerechten und harmonischen Zusammenlebens vereinbar ist. Denn das Kind muss natürlich lernen,
die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder zu respektieren. Elterliches verhalten, das deren
eigene egoistische Bedürfnisse in den Vordergrund stellt,
[Seite 7] ist hierbei von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Erziehung setzt daher unter allen Umständen
Selbsterziehung voraus. Es geht darum, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden, Interessen
auszubalancieren und so gerecht wie möglich zu sein. Wir müssen dabei nicht vollkommen sein und
uns hüten, den Eindruck von Unfehlbarkeit zu erwecken. Nur wenn Kinder ihre Erzieher als Menschen
erfahren, die sich bemühen und auch Fehler machen, können sie ein realistisches Selbstbild
gewinnen. So besteht das Vorbild der Eltern nicht darin, dass sie alles richtig machen, sondern
darin, dass sie bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren.
ist hierbei von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Erziehung setzt daher unter allen Umständen
Selbsterziehung voraus. Es geht darum, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden, Interessen
auszubalancieren und so gerecht wie möglich zu sein. Wir müssen dabei nicht vollkommen sein und
uns hüten, den Eindruck von Unfehlbarkeit zu erwecken. Nur wenn Kinder ihre Erzieher als Menschen
erfahren, die sich bemühen und auch Fehler machen, können sie ein realistisches Selbstbild
gewinnen. So besteht das Vorbild der Eltern nicht darin, dass sie alles richtig machen, sondern
darin, dass sie bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren.
Man hat nur wenig für einen Menschen getan,
wenn man nichts anders für ihn getan hat,
als ihn in die Welt zu setzen.
- Arthur Schnitzler, 1862 bis 1931
- Arzt, Schriftsteller, Dramatiker
Roland Greis
Fotos: M. Willems S. 4+5; R. Greis S. 6+7
UNTERNEHMEN ZUKUNFT[Bearbeiten]
Woher die Zuversicht,
dass ein Unternehmen Familie
heute noch
gelingen kann?
Täglich die Nachricht
egozentrischer Dummheit
auf Kosten der Schwachen.
Täglich mediale Verführung
zur Ignoranz.
Täglich der Showdown
der Selbsterniedrigung,
vermarktet als Sensation.
Und überall die Opfer
von Gewalt, Vernachlässigung, Rücksichtslosigkeit:
suchende Süchtige auf dem Weg durch die Finsternis.
Während die globalen Verderber
das Wettrennen
um die Vergiftung des letzten Flusses
und den Kahlschlag des letzten Waldes,
den blindwütigen Kampf
um die Vernichtung des Planeten
in die letzte Runde treiben.
Woher da die Kraft nehmen
Apfelbäume zu pflanzen?
ICH HABE DICH REICH ERSCHAFFEN,
WARUM MACHST DU DICH SELBST ARM?
EDEL ERSCHUF ICH DICH;
WARUM ERNIEDRIGST DU DICH SELBST?*
Wenn die Finsternis überhand nimmt,
ist es Zeit
Kerzen zu gießen.
Wenn die Kälte sich ausbreitet,
hilft es
einander zu wärmen.
Wenn das Alte zerfällt,
muss das Neue begonnen werden.
Was also ist die Antwort
auf Tod und Zerstörung,
Feindschaft und Hass?
MEINE LIEBE IST MEINE FESTE.
WER SIE BETRITT,
IST SICHER UND WOHLBEHÜTET;
WER SICH ABER ABWENDET,
WIRD WAHRLICH IRREGEHEN UND VERDERBEN.*
Die andere Welt
beginnt
wie alles
ganz klein.
Mit einem Händedruck
angesichts militärischen Größenwahns,
einer Umarmung
im Rücken aufgestellter Armeen,
einem Lächeln,
das die Feindbilder in Frage stellt.
Sie beginnt,
wenn Kinder
lernen,
dass Liebe
ein besserer Schutz ist
als Drohung, Habgier, Selbstsucht, Gewalt.
Roland Greis
- BAHÁ’U’LLÁH, VERBORGENE WORTE
Ohne Familie keine Gesellschaft[Bearbeiten]
ALLE RELIGIONEN BESTÄTIGEN DIE BEDEUTUNG DER FAMILIE FÜR DEN EINZELNEN UND DIE GEMEINSCHAFT
Die Großfamilie hat sich in den westlichen Ländern in den vergangenen 150 Jahren allmählich aufgelöst, derzeit hat dieser Prozeß die Kernfamilie erreicht. Aufgrund der fortschreitenden Individualisierung ist die Ehe nicht länger eine unauflösliche, heilige Institution, wer eine sexuelle Gemeinschaft haben will, braucht nicht zu heiraten. Die zunehmende Zahl der Scheidungen und neu geschlossene Ehen führen zu höchst vielfältigen Arten von „Stieffamilien“1). Dadurch verändern sich Verwandtschaftsbeziehungen. Aus der Elternperspektive wird nun von „deinen, meinen, unseren Kindern“ gesprochen.
Frei vom Zwang, als Paar zusammenhalten zu müssen, um das Leben zu meistern, kommen Partnerbeziehungen in die Krise aufgrund der völlig neuen Herausforderung, eine persönliche Liebesbeziehung aufzubauen und Werte zu finden, die der Partnerschaft Sinn geben. Welche Werte und Normen gibt welche Familie jetzt weiter?
Die Familie ist heute kein Garant für Stabilität und Sicherheit mehr. Es fehlt vielen Paaren die Vision, gemeinsam und glücklich alt zu werden.2) Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2000 rund 418.550 Ehen geschlossen und 194.408 geschieden. Dennoch steht Familie bei den Deutschen hoch im Kurs: Zwei von drei sind davon überzeugt, dass Kinder das Leben intensiver und erfüllter machen.[..] Die meisten glauben auch, dass in der Familie soziale Werte am besten vermittelt werden: 56 Prozent teilen diese Aussage „voll und ganz“ [...].3)
Parallel zu der zunehmenden Auflösung der Familie kamen die systemischen Erkenntnisse in der Psychologie auf, die unter anderem psychosomatische Krankheitssymptome eines Menschen als Ausdruck des kranken Familiensystems erkannten. Daraus schloss man, dass zur Heilung die gesamte Familie therapiert werden sollte. Wenn der Mensch meinte, er sei frei in seinen Entscheidungen, so belehren ihn diese Erkenntnisse eines besseren: Er ist Ordnungen und Regeln unterworfen; er ist mit seiner Familie verbunden und kann sein Wohl nur erhalten, wenn er sich allen Mitgliedern in Liebe zuwendet. Das für sich zu akzeptieren bedingt das Wissen um Abhängigkeit und Erziehung. Aber wer gibt diese Ordnungen vor, was ist unsere Natur? Auf diese Fragen kann die Psychologie keine Antwort geben, sie zeigt nur Phänomene auf. Auf diese Fragen kommen die Antworten aus der Religion.
Der Mensch könnte sich nach der „Ordnung der Liebe“4) richten, um innerhalb der Großfamilie in Frieden zu leben. Diese Ordnung ist nichts Neues. Sie ist ein Teil der offenbarten göttlichen Lehren, die sich auf die Familie beziehen. Bert Hellinger hat durch die Familienaufstellungen5) aufzeigen können, wie diese Ordnung wirkt, und wie das Wohl und Wehe einer Familie von ihrer Einhaltung abhängt. Da die Regeln aber immer wieder übertreten werden, da Krisen, traumatische Erlebnisse die Familie von außen bedrohen und zerrütten können, sind alle ständig aufgefordert, die Ordnung wieder herzustellen.
Um in Selbstkontrolle zu leben, ethische Maßstäbe des Handelns anzuwenden, Rücksicht zu nehmen auf andere, bedarf der Mensch der Erziehung, damit er erkennt, dass sein Glück in der Befolgung ethischer, religiöser Gebote und Gesetze liegt.
[Seite 10] Ohne Erziehung verirrt sich der Mensch im Labyrinth seiner Lüste auf der Suche nach
seinem Glück und nach wahrer Liebe. Wenn er die Quelle seines geistigen Seins nicht
beachtet, wenn er nicht erkennt, dass er eine geistige Natur hat, fehlen ihm die Kraft
und der Anstoss, nach den Geboten zu leben.6) Wie sonst könnte man erklären,
dass im Mensch angelegte Ordnungsprinzipien, die den einzelnen ebenso wie die Gesellschaft
zu Frieden und Wohlfahrt führen, ständig Übertreten werden? Es gilt zum Beispiel, die Toten
zu achten, allen Mitgliedern ihren angemessenen Platz zu geben, die Eltern zu achten,
Unrecht zu sühnen, Gerechtigkeit walten zu lassen, zu geben und zu danken. Das alles
sind religiöse Gesetze.
Ohne Erziehung verirrt sich der Mensch im Labyrinth seiner Lüste auf der Suche nach
seinem Glück und nach wahrer Liebe. Wenn er die Quelle seines geistigen Seins nicht
beachtet, wenn er nicht erkennt, dass er eine geistige Natur hat, fehlen ihm die Kraft
und der Anstoss, nach den Geboten zu leben.6) Wie sonst könnte man erklären,
dass im Mensch angelegte Ordnungsprinzipien, die den einzelnen ebenso wie die Gesellschaft
zu Frieden und Wohlfahrt führen, ständig Übertreten werden? Es gilt zum Beispiel, die Toten
zu achten, allen Mitgliedern ihren angemessenen Platz zu geben, die Eltern zu achten,
Unrecht zu sühnen, Gerechtigkeit walten zu lassen, zu geben und zu danken. Das alles
sind religiöse Gesetze.
Die Verbindung von Mann und Frau und die Familie sind als Voraussetzung für eine gesunde Gesellschaft so wichtig, dass alle heiligen Schriften sich dazu äußern:
- „Kein Mann ohne Frau, keine Frau ohne Mann, noch beide ohne Gott.“ 7)
- „Wer keine Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Glück, ohne Seligkeit.“ 8)
- „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.“ 9)
- „Was denn Gott zusammen gefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“10)
- „Und zu Seinen Zeichen gehört es, dass Er euch von euch selber Gattinnen erschuf, auf dass ihr Ihnen beiwohnet, und Er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt."11)
- „Gott hat gesagt: Ehre Vater und Mutter! Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden." 12)
Unter den zehn Geboten Mose sind für die eheliche und familiäre Beziehung wichtig:
- „Ehre Vater und Mutter“ „Du sollst weder deines Nachbarn Haus begehren, noch sein Weib, noch irgendetwas, was ihm gehört.“ 13)
Die Bahá’í-Lehren zu Ehe und Familie bekräftigen die Wahrheit dieser Zitate und erweitern sie
Bahá’u’lláh bringt den Menschen in einer Zeit der Auflösung der Familie ins Bewusstsein, dass die
Ehe eine heilige Institution bleibt14), die kein Gottesbote je auflösen wird. Die
Verbindung von Mann und Frau wird eine ewige sein, die auch nach dem Tode fortbesteht, und die
Einheit des Paares ist die Grundlage für die Einheit der Familie. Als Paar sollen sie mit ihrem
Heim, ein „Hafen der Ruhe und des Friedens sein“. Sie sollen „gastfrei“ sein und die
„Türe“ ihres „Hauses offen halten für Freunde und Fremde“. Und wenn Gott ihnen
„süße und liebliche Kinder schenkt", so sollen sie sich ihrer
„Belehrung und Führung widmen“.15)
Hier erkennen wir die göttlichen Ordnungen, die für Familien gelten: die Liebe und Zuneigung des Paares, seine unbedingte Treue zueinander und seine Arbeit an der Beziehung hin zu einer geistigen Verbundenheit. Außerdem sollen sich die beiden dem Dienst an der Gesellschaft widmen und Kinder erziehen. Einheit, das zentrale Prinzip des Bahá’í-Glaubens, beginnt in der Familie
- „Nach den Lehren Bahá’u’lláhs soll die Familie als eine menschliche Einheit nach den Regeln der Heiligkeit erzogen werden. Alle Tugenden sind der Familie zu lehren. Die Familienbande sind unversehrt zu bewahren; die Rechte der Familienmitglieder dürfen nicht verletzt werden, weder die des Sohnes noch die des Vaters oder der Mutter. Niemand darf rücksichtslos sein. Wie der Sohn bestimmte Pflichten gegenüber dem Vater hat, so hat der Vater Pflichten gegenüber dem Sohn. Die Mutter, die Schwester und die anderen Haushaltsmitglieder haben ihre eigenen Vorrechte. Alle diese Rechte müssen gewahrt werden, doch die Einheit der Familie muss erhalten bleiben. Die Schädigung eines Familienmitgliedes soll als die Schädigung aller gelten, das Wohl eines als das Wohl aller, die Ehre eines als die Ehre aller.“ 16)
Die Pflichten innerhalb der Familie hören nicht mit der Erziehung auf. Kinder sind nicht nur Empfänger von Liebe und Erziehung, sie sollen auch, entsprechend ihrer Reife und ihrem Alter, den Eltern Wohltätigkeit erweisen. Werden diese Rechte mit der Liebe Gottes verbunden, fördern sie die gesunden Familienbande. Dabei ist auf die Ordnung zu achten:
- „Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, nicht die Eltern den Kindern. Eltern haben ihre Kinder zu erziehen und nicht umgekehrt.“ 17)
[Seite 11] Mit der Einhaltung von Rechten und Pflichten kann leichter vermieden werden, dass Eltern ihre Kinder
als Partnerersatz „missbrauchen“ oder dass Eltern eine Bedürftigenrolle gegenüber ihren Kindern
einnehmen. Es ist damit klar, dass auch Eltern sich Pflichten unterordnen müssen und dafür vor Gott
zu verantworten haben. Das führt bei ihnen zu einem ständigen Reifungsprozess.
Mit der Einhaltung von Rechten und Pflichten kann leichter vermieden werden, dass Eltern ihre Kinder
als Partnerersatz „missbrauchen“ oder dass Eltern eine Bedürftigenrolle gegenüber ihren Kindern
einnehmen. Es ist damit klar, dass auch Eltern sich Pflichten unterordnen müssen und dafür vor Gott
zu verantworten haben. Das führt bei ihnen zu einem ständigen Reifungsprozess.
Der Prozess, um vom Stadium des abhängigen Kindes zu dem eines Kindes Gottes zu kommen, wird durch das Beten für die Eltern unterstützt: Wenn das Kind erwachsen wird und lernt, die Welt mit eigenen Augen zu sehen, beginnt es, die Eltern in ihrem Handeln kritisch zu betrachten. Früher oder später fallen sie von dem Thron, auf den sie vom Kind gehoben wurden und es erkennt, dass seine Eltern ganz normale sterbliche Menschen sind, mit Unvollkommenheiten und Schwächen, mit ihren eigenen Regeln untereinander und mit ihrem eigenen Kind-Sein gegenüber ihren Eltern und gegenüber Gott. Mit der Pflicht, für die Sünden seiner Eltern zu beten, erleichtert Gott ihm diese Phase. Die Eltern sind voller Fehler. Ein Kind kann aber nicht die Fehler der Eltern vergeben. Es soll dafür Gott inständig anflehen, seinen Eltern zu verzeihen.
- „Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes Ruf erschallen: „Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine Eltern erbeten hast!“ Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Mächtigen, dem Vielgeliebten.“ 18)
Ob wir gläubig sind oder nicht - wir sind in ein Ordnungssystem eingebunden, aus dem wir uns nicht befreien können. Das Wohl eines Familienmitglieds ist das Wohl aller. Sein Unglück ist das Unglück aller. Das sind Erkenntnisse der Psychologie. Ein Ordnungssystem kann nur von einem Urheber stammen, der um die Natur des Menschen weiß. Dazu ist kein Mensch von sich aus fähig. Ordnungsgeber jedoch erscheinen seit Menschengedenken. Jede Gesellschaft anerkennt die zehn Gebote Mose, ohne dem jüdischen Glauben anzugehören. Das Christentum betonte die Heiligkeit der Ehe und Mohammed bekräftigte den Bund zwischen Mann und Frau, verbunden mit Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit.
Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Sie schafft die Grundlage für Einheit in der Gesellschaft. Voraussetzung ist, ihre Regeln und Gebote anzuerkennen und sie mit der Liebe zu Gott zu verbinden. Wenn wir bewusst danach handeln, kann die Liebe im Guten wirken und die Einheit festigen. Im anderen Fall wenden sich die Regeln gegen uns, denn dann handeln wir blind und können keine Fortschritte machen.19)
QUELLENANGABEN:
- 1) MITTERAUER, ORTMAYR HRSG., FAMILIE IM 20. JAHRHUNDERT, S.23FF
- 2) STATISTISCHES AMT UND WAHLAMT BREMERHAVEN
- 3) WWW.VITAWO.DE/DETAILA.HTM
- 4) SO NENNT BERT HELLINGER SEINE ERKANNTEN ORDNUNGSPRINZIPIEN INNERHALB DER FAMILIE, DIE AUF BOSZORMENY NAGYS ERKENNTNISSEN AUFBAUEN
- 5) SIEHE DAZU ULSAMER BERTOLD, DAS HANDWERK DES FAMILIENAUFSTELLENS; ODER ULSAMER, OHNE WURZELN KEINE FLÜGEL
- 6) DARAUF MACHT SCHON GAUTAMA BUDDHA AUFMERKSAM, WENN ER SAGT: „ROST ERZEUGT SICH AUS DEM EISEN, EISEN WIRD VOM ROST ZERFRESSEN. DURCH SEIN EIGEN TUN GEHT UNTER, WER DAS PFLICHTGESETZ VERGESSEN.“ GAUTAMA BUDDHA: DAS HOHE LIED DER WAHRHEIT, EDITION HERDER 1992, S.95
- 7) MIDRASCH: BERESCHIT RABBA 8,9 ZIT.IN WWW.PAYER.DE/JUDENTUM/JUD502.HTML
- 8) ALTES TESTAMENT, TALMUD JEBAMOT 62B
- 9) ALTES TESTAMENT, GENESIS 1,28
- 10) BIBEL, DAS EVANGELIUM NACH MARKUS, 9.10:9
- 11) DER KORAN, SURE 30:2
- 12) NEUES TESTAMENT, MATTHÄUS 15,4
- 13) WWW.PURAMARYAM.DE/GESETZGEBOT.HTML
- 14) WIE ES EHEMALS DIE KATHOLISCHE KIRCHE SELBER FORMULIERTE
- 15) ‘ABDU'L-BAHÁ, ANSPRACHE ANLÄSSLICH EINER HOCHZEIT, ZIT. IN LIEBE UND EHE, S. 28-31
- 16) ‘ABDU'L-BAHÁ ZIT. IN EINHEIT DER FAMILIE, S. 22
- 17) VERGL. DAZU BOTSCHAFT DES UNIVERSALEN HAUSES DER GERECHTIGKEIT, RIDVAN BOTSCHAFT 2000 AN DIE BAHÁ'Í DER WELT, ZIT. IN KINDERERZIEHUNG, S.34
- 18) A.A.O. S.10
- 19) SCHILLERT, MANUSKRIPT „MIT DEM SEGEN DER ELTERN“, ERSCHEINT VORAUSSICHTLICH ENDE 2005
Hilde Schillert
Lehrtrainerin beim Deutschen Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren
Individualpsychologische Beraterin
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie
eigene Beratungs- und Seminarpraxis.
Not macht erfinderisch und offen für neue Ideen[Bearbeiten]
Das Engagement der Bahá’í löst eine Sozialreform aus
Ein Bericht aus dem Jahr 2030
Man schreibt das Jahr 2030.
Markus Kühne beendet seine Arbeit auf der Bank wie immer mittwochs bereits um 12 Uhr, denn am Nachmittag hat er einen wichtigen Termin. Um 16 Uhr findet nämlich im Bürgersaal regelmäßig eine öffentliche Andacht statt, die er zusammen mit einigen Bahá’í-Freunden vorbereitet. Diese Andachten sind mittlerweile zu einer festen und gern besuchten Einrichtung geworden. Neben Gebet, Stille und dem Hören heiliger Texte aus verschiedenen Religionen ist diese Andacht auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Markus Kühne freut sich jedesmal auf den Mittwochnachmittag, auch wenn die Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nimmt. So wie ihm geht es den acht anderen Mitgliedern des Vorbereitungsteams, die sich wie er für die Andachten in ihrer Stadt verantwortlich fühlen.
Aber Markus Kühne hat noch einen weiteren Termin an diesem Abend, den er mit Spannung erwartet. Im Bahá’í-Zentrum tagt der Örtliche Geistige Rat und wird darüber entscheiden, ob das Engagement von Markus Kühne im Andachtsteam es weiterhin rechtfertigt, ihn für diese Tätigkeit jeden Mittwochnachmittag freizustellen.
Kühne sitzt im Vorraum und versucht, gegen seine Unruhe ein paar Gebete zu sprechen, doch wie so oft will es ihm nicht gelingen. Endlich öffnet sich die Tür und er wird herein gebeten. Die Vorsitzende des Geistigen Rates begrüßt ihn freundlich und dankt ihm für seinen Einsatz in den vergangenen sechs Monaten. Als sie ihm das Ergebnis der Beratung mitteilt, atmet er erleichtert auf. Seine Arbeit im Andachtsausschuss bringt auch für die nächsten sechs Monate die benötigte Anzahl von Punkten auf sein Sozialkonto, um den Mittwochnachmittag frei nehmen zu können.
Das Einrichten von Sozialkonten durch die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Geistigen Rat der Bahá’í hat es Markus Kühne ermöglicht, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen: weniger im Büro zu arbeiten und dafür mehr Zeit zu haben für das Gestalten von öffentlichen Andachten und Gebetsrunden. Früher hatte die Familie für sein Engagement Opfer bringen müssen, denn jede Stunde, die er dafür brauchte, ging seinen Lieben ab. Jetzt kann er dafür reguläre Arbeitszeit verwenden und hat wieder mehr Zeit für die Familie.
Das System, das vor einigen Jahren flächendeckend eingeführt wurde, funktioniert folgendermaßen:
Für seinen Einsatz rund um die Andachten erhält Markus Kühne eine bestimmte Anzahl von Punkten
auf sein Sozialkonto. Diese Punkte kann er zum Beispiel bei seinem Arbeitgeber einreichen und
dafür Freistunden nehmen. Die Bank wiederum
[Seite 13] verwendet diese Punkte, um einen Krippenplatz für eine ihrer Mitarbeiterinnen einzurichten,
deren Kleinkind während der Arbeitszeit betreut werden muss. Die Frau, die das Kind betreut,
kann die Punkte sehr gut brauchen, damit jemand mit ihren gebrechlich gewordenen Eltern einkaufen
geht, ihnen vorliest oder für sie Briefe am Computer schreibt. Das macht ein junges Mädchen, das
sich damit Punkte für das Ferienlager der Bahá’í in Mazedonien verdient. Denn bei Abgabe der Punkte
zahlt die Bank einen Zuschuss für die Fahrt. Das System umfasst die Erziehung von Kindern, die
häusliche Pflege und eine große Zahl von sozialen, öffentlichen und kulturellen Ehrenämtern, die
offiziell als „Bürgerarbeit“ bezeichnet werden. Und für Bürgerarbeit gibt es „Bürgergeld“, eben
jene Punkte auf dem Sozialkonto.
verwendet diese Punkte, um einen Krippenplatz für eine ihrer Mitarbeiterinnen einzurichten,
deren Kleinkind während der Arbeitszeit betreut werden muss. Die Frau, die das Kind betreut,
kann die Punkte sehr gut brauchen, damit jemand mit ihren gebrechlich gewordenen Eltern einkaufen
geht, ihnen vorliest oder für sie Briefe am Computer schreibt. Das macht ein junges Mädchen, das
sich damit Punkte für das Ferienlager der Bahá’í in Mazedonien verdient. Denn bei Abgabe der Punkte
zahlt die Bank einen Zuschuss für die Fahrt. Das System umfasst die Erziehung von Kindern, die
häusliche Pflege und eine große Zahl von sozialen, öffentlichen und kulturellen Ehrenämtern, die
offiziell als „Bürgerarbeit“ bezeichnet werden. Und für Bürgerarbeit gibt es „Bürgergeld“, eben
jene Punkte auf dem Sozialkonto.
Markus Kühne erinnert sich noch gut daran, wie alles begann: Zum Jahreswechsel 2015 auf 2016 erreichte die Finanzkrise in der Bundesrepublik Deutschland auch die Kirchen. Immer mehr kirchliche und soziale Einrichtungen mussten ihre Arbeit wegen Zahlungsunfähigkeit einstellen, bis das System zusammenbrach. Das war für viele Menschen ein unsanftes Erwachen, als sie entdeckten, dass sie nicht nur keine Kirche mehr hatten, sondern auch keinen Glauben, keine Werte und kaum noch intakte Familien. Das Gemeinschaftsleben war unmerklich immer mehr eingeschlafen, bis der Zusammenbruch kam und eine riesige Lücke hinterließ, die nicht mehr zu übersehen war.
Markus hatte früher nie verstanden, warum die Bahá’í-Gemeinde immer wieder öffentliche Andachten, Glaubenskurse und Kinderklassen anbot, von denen aber kaum einer etwas wissen wollte. Jetzt verstand er es: Sie hatten trainiert. Jetzt waren sie fit und konnten etwas tun, um die Lücke zu füllen. Sie luden zu öffentlichen Andachtsversammlungen ein und die Menschen kamen. Sie kamen, weil sie spürten, dass sie orientierungslos geworden waren und weil sie Halt suchten. Die Andachten waren offen für alle. Es wurde niemand bepredigt oder in Rituale gezwängt. Jeder durfte sein, wie er war und brachte mit, was er hatte, an Gedanken, Fragen, Wissen, an Liedern und Gebeten. Es wurden Texte vorgetragen aus allen großen Religionen der Welt.
Dazu Gebete und Lieder. Worte und Töne, Stimmen, Bewegungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, Tanz. Und im Mittelpunkt Gottes Wort, wie er zu allen Zeiten gesprochen hat durch die Propheten. Gebete und Texte konnten mitgenommen werden, zum Nachlesen und Nachwirken lassen. Viele Besucher gingen nachdenklich nach Hause. Wie viel Reichtum hatten sie verloren und nicht einmal vermisst.
In den religiösen Gesprächskreisen, den Ruhi-Kursen, lernten die Menschen die Namen Gottes neu zu buchstabieren, was man beinahe wörtlich nehmen kann, denn sie waren im Lauf der Zeit zu spirituellen Analphabeten geworden. Zum Bespiel pflegten ältere Herrschaften, denen etwas Schlimmes widerfuhr, die Hände über dem Kopf zusammen zuschlagen und „Heiliger Pankratius“ zu rufen. Wahrscheinlich wussten sie gar nicht, wen sie damit meinten. Später schlug man mit der Faust auf den Tisch und schrie: „Ich habe einen Virus.“ Doch man meinte damit nicht sich selbst, sondern seinen Computer. Heute breiten die Menschen die Hände aus und sagen: „Gott genügt allen Dingen und über alle Dinge hinaus.“ Oder „Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott?“ Und sie wissen, was sie damit meinen, denn sie haben Sätze, die Gott den Menschen anvertraut hat, nicht nur auswendig gelernt, sondern in den Ruhi-Kursen am eigenen Leib erfahren. Und sie haben gelernt, davon zu erzählen. Auch den Kindern.
Kinder suchen die Herausforderung und haben Freude daran, Neues zu entdecken und zu lernen. Gibt man ihnen Spiele, bei denen möglichst viele außerirdische Monster zu killen sind, werden sie sich damit beschäftigen. Aber mit der gleichen Freude und Neugier besuchen sie heute die neu entstandenen Kinderklassen. Markus hatte „Kinderklassen“ immer für ein schreckliches Wort gehalten, das man durch etwas Neues, Lustvolleres er setzen sollte. Aber darauf kommt es jetzt gar nicht mehr an. Die Lust liegt in der Gruppe selbst und in dem, was sie tut.
Spielerisch lernen die Kinder die großen Geheimnisse kennen, die Geschichten von Gott und seinen Propheten. Wirkliche Geheimnisse und Abenteuer, keine virtuellen. Und sie malen und spielen aus der Wirklichkeit, nicht am Bildschirm. Sie lernen Tugenden kennen und wie schön das Leben sein kann, wenn Menschen sich richtig verhalten und sie üben sich darin, die Tugenden in die Tat umzusetzen. Für jeden kleinen Erfolg werden sie belohnt. Dazu muss man gar nicht viel tun, denn jede gute Tat belohnt sich selbst. Sie sind mit großem Eifer und wachsender Begeisterung bei der Sache. Oft überraschen sie die Eltern mit neuen Erkenntnissen und kleinen Weisheiten und bringen sie zum Staunen. Wie das Kind, das nach Hause kommt und fragt: „Wir haben heute Beratung gespielt. Können wir nicht auch eine Familienkonferenz haben?“
[Seite 14] Das war die Phase, in der die Bahá’í begannen, eine Art Tauschbörse ins Leben zu
rufen, weil ihnen die Arbeit über den Kopf wuchs. Vielleicht auch deshalb, weil viele
Kinder sich beschwerten, sie würden ihre Eltern nur noch bei Bahá’í-Veranstaltungen
zu Gesicht bekommen. Den Erwachsenen war nicht bewusst, dass sie mit dieser
Tauschbörse zum Vorbild und Vorreiter wurden. Die kommunalen Verwaltungen
wurden darauf aufmerksam und fragten sich angesichts leerer Sozialkassen, ob das
nicht ein Modell für die Zukunft sein könnte. Nach anfänglichem Zögern begannen
einige Kommunen, das System zu Übernehmen, auszubauen und auf breitere Füße
zu stellen. Das löste einen Evolutionsprozess aus, wie ihn Deutschland lange nicht
mehr gesehen hatte. Durch die verstärkt einsetzende ehrenamtliche Tätigkeit vieler
Einwohner sanken die Kosten für soziale Dienste. Das entlastete private und öffentliche
Haushalte gleichermaßen und schuf Freiräume. Immer mehr Menschen stellten
fest, dass sie es sich jetzt leisten konnten, ihre Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Das
half, die Arbeitslosigkeit zu vermindern und sparte der Regierung Milliardenbeträge
Die wiederum konnten verwendet werden, um die Aktion auch finanziell auf eine
solide Basis zu stellen. Unternehmen beteiligten sich am Punktesystem entweder
durch eine Wertschöpfungsabgabe oder sie „kauften“, wie im Fall der Bank von
Markus Kühne, große Mengen von Punkten auf und boten sie ihren Mitarbeitern als
Sozialleistung an.
Das war die Phase, in der die Bahá’í begannen, eine Art Tauschbörse ins Leben zu
rufen, weil ihnen die Arbeit über den Kopf wuchs. Vielleicht auch deshalb, weil viele
Kinder sich beschwerten, sie würden ihre Eltern nur noch bei Bahá’í-Veranstaltungen
zu Gesicht bekommen. Den Erwachsenen war nicht bewusst, dass sie mit dieser
Tauschbörse zum Vorbild und Vorreiter wurden. Die kommunalen Verwaltungen
wurden darauf aufmerksam und fragten sich angesichts leerer Sozialkassen, ob das
nicht ein Modell für die Zukunft sein könnte. Nach anfänglichem Zögern begannen
einige Kommunen, das System zu Übernehmen, auszubauen und auf breitere Füße
zu stellen. Das löste einen Evolutionsprozess aus, wie ihn Deutschland lange nicht
mehr gesehen hatte. Durch die verstärkt einsetzende ehrenamtliche Tätigkeit vieler
Einwohner sanken die Kosten für soziale Dienste. Das entlastete private und öffentliche
Haushalte gleichermaßen und schuf Freiräume. Immer mehr Menschen stellten
fest, dass sie es sich jetzt leisten konnten, ihre Wochenarbeitszeit zu reduzieren. Das
half, die Arbeitslosigkeit zu vermindern und sparte der Regierung Milliardenbeträge
Die wiederum konnten verwendet werden, um die Aktion auch finanziell auf eine
solide Basis zu stellen. Unternehmen beteiligten sich am Punktesystem entweder
durch eine Wertschöpfungsabgabe oder sie „kauften“, wie im Fall der Bank von
Markus Kühne, große Mengen von Punkten auf und boten sie ihren Mitarbeitern als
Sozialleistung an.
Die gewonnene Zeit kam den Familien zu Gute, förderte Talente und Hobbys und floss letztendlich als Bereicherung über die Tauschbörse wieder in das Gemeinwesen ein.
Manchmal fragt sich Familie Kühne, warum das alles so lange gedauert hat und warum so viel passieren musste, bis es geschah. Aber dann fällt ihnen ein, was Bahá’u’lláh, der Stifter der Bahá’í-Religion, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gesagt hat: „Der Allwissende Arzt legt seinen Finger an den Puls der Menschheit. Er erkennt die Krankheit und verschreibt in Seiner unfehlbaren Weisheit das Heilmittel. .... Neues Leben durchpulst in dieser Zeit alle Völker der Erde, und doch hat keiner seine Ursache entdeckt und seinen Grund erkannt.“ (Ährenlese 106:1 + 96:2)
- Thomas Schaaff
- Dipl-Theologe und Pädagoge,
- verheiratet,
- ehemals kath. Pfarrer,
- seit dem Jahr 2000 Bahá’í.
- Arbeitet haute als
- Meditationslehrer
Dass wir wieder werden wie die Kinder,
ist eine unerfüllbare Forderung.
Aber wir können zu verhüten suchen,
dass die Kinder werden wie wir.
- Erich Kästner, 1899-1974
- Schriftsteller, Drehbuchautor, Kabarettist
Kein Märchen ........ eine glückliche Kindheit[Bearbeiten]
Sich geliebt und zugehörig zu fühlen ist das Wichtigste
„Liebling“, begann meine Frau in ihrem verführerischsten Ton. Ich dachte sofort, dass
etwas Größeres auf mich zu kommt, denn obwohl wir beide nebeneinander lagen und uns
anschauten, gelang es ihr irgendwie, mit großen, herzerweichenden braunen Augen zu mir
aufzuschauen. Was würde jetzt kommen, fragte ich mich. Wollte sie, dass wir schon wieder
ihre langweiligen Freunde besuchten? Oder noch schlimmer, sie einladen? Ich hätte nicht
schiefer liegen können. „Du weißt, ich werde nicht jünger und meine biologische Uhr tickt
und wir haben doch gesagt, dass wir Kinder wollen... Findest du nicht auch, dass es Zeit
ist, an eine Familie zu denken?“
Es dauerte eine Weile, bis ich antworten konnte. Millionen Gedanken liefen vor meinem inneren Auge ab. Gute Gedanken übrigens. Ich hatte nämlich eine unmodern glückliche Kindheit. Ich sage unmodern, weil viele meiner Freunde und Bekannten aus allen Generationen Stunden damit verbringen, sich mit Horrorgeschichten über ihre gefühllosen Eltern auszulassen. Ich fühle mich immer fehl am Platze, wenn versucht wird, mich an solchen Gesprächen zu beteiligen.
Wenn Leute zum Beispiel darüber jammern, dass sie einen Raum mit einem Bruder oder einer Schwester teilen mussten, die sie nicht ausstehen konnten, bin ich manchmal versucht, einen verspäteten Protest loszulassen, dass ich ein Bett mit meinen beiden jüngeren Brüdern teilen musste, bis ich vierzehn war - die zwei älteren Brüder hatten eigene Betten im selben Raum. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, damit ein Problem gehabt zu haben. Noch schwerer fällt mir, für eine Bekannte Mitgefühl zu entwickeln, die glaubt, nie geliebt worden zu sein, weil sie einer unerwünschten dritten Schwangerschaft entstammt. Was soll ich dazu sagen, frage Ich mich im Stillen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass meine Eltern mich als sechstes von neun Kindern geplant haben. Aber ich bin nun mal da, also versuche ich das Beste draus zu machen.
Ich will mich keinesfalls über die Probleme dieser Leute lustig machen. Einige davon sind wirklich schwer und zweifellos alle werden von den Betroffenen so empfunden. Aber ich glaube, dass viele dieser Probleme daher kommen, dass die betreffenden Menschen nicht das Gefühl hatten, geliebt zu werden. Das war Gott sei Dank nie das Gefühl, das eines von uns Geschwistern zum Ausdruck brachte. Natürlich haben wir uns auch über unser Schicksal beklagt. Aber unsere Klagen galten eher dem Wetter, den Steuern oder der Unfähigkeit politischer Führer - Dinge, auf die der Durchschnittsbürger keinen Einfluss hat.
Demzufolge war meine einzige Frage auf den Familienwunsch meiner Frau, ob und inwieweit ich in der Lage sei, den hohen Maßstäben gerecht zu werden, unter denen ich aufgewachsen bin.
Wir waren elf mit unseren Eltern, und die Großfamilie bestand aus einigen Hundert, inklusive
Onkel, Tanten, Cousins und eine Großmutter. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals einer von
ihnen die Art von Beschwerde über seine Erziehung äußerte, die ich oft in diesem viel
wohlhabenderen Land gehört habe. Das gilt auch für meine Freunde.
[Seite 16] Was ist der Grund dafür? Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft, in der ich aufwuchs, irgendwie
eine große Familie war. Was hat sie dazu gemacht? War es die Armut, die wir alle teilten? War es
das gemeinsame Gefühl, in einem Boot zu sitzen?
Was ist der Grund dafür? Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft, in der ich aufwuchs, irgendwie
eine große Familie war. Was hat sie dazu gemacht? War es die Armut, die wir alle teilten? War es
das gemeinsame Gefühl, in einem Boot zu sitzen?
Es sind viele Bücher über dieses Thema geschrieben worden und einige stimmen darin überein, dass wir mit wachsendem Reichtum immer unglücklicher werden. Als eine Ursache der heutigen Probleme wird oft der Verfall der traditionellen Familie genannt. Stimmt das wirklich?
Was bedeutet überhaupt das Wort Familie? In seinem Buch „The Third Wave“ zählt der Zukunftsforscher Alvin Toffler 81 verschiedene Arten von Familien auf, die es heute in den Vereinigten Staaten gibt.
In Webster’s online dictionary steht zur Definition von Familie:
- Familie: Die Grundeinheit der Gesellschaft, die traditionell aus zwei Eltern besteht, die ihre eigenen oder adoptierte Kinder großziehen; auch: jede andere soziale Einheit, die sich davon unterscheidet, aber der traditionellen Familie entspricht, etwa die Familie mit einem Elternteil.
- Clan: Eine Gruppe von Menschen gleicher Vorfahren; ethnische Zugehörigkeit: ein Volk oder eine Gruppe von Menschen mit gleicher Abstammung.
In Irland war meine Familie ziemlich traditionell. Meine Mutter war zu Hause, mein Vater ging arbeiten wie auch alle meine Brüder und Schwestern, sobald sie 14 Jahre alt waren. Alles verdiente Geld wurde meiner Mutter übergeben, die ihr wirtschaftliches Talent dadurch bewies, dass sie uns nicht nur ernährte und einkleidete, sondern auch noch Rücklagen für ein eigenes Haus bildete, in das wir einzogen, als ich acht Jahre alt war. Jeder von uns hatte bestimmte Arbeiten zu erledigen und gewisse Pflichten wahrzunehmen. In einem Gespräch, das ich vor kurzem mit meiner ältesten Schwester führte, kamen wir zu dem Ergebnis, dass eines der Probleme in heutigen Familien das Fehlen solcher Pflichten ist. Sie erinnert sich, wie wichtig sie sich als Fünfzehnjährige fühlte, weil das Geld, das sie zur Haushaltskasse beisteuerte, einfach unentbehrlich war. Abgesehen vom Geld, das sie dazugaben, halfen die älteren Jungen und Mädchen unserer Mutter mit den jüngeren Kindern und im Haushalt einschließlich dem Kochen. Keiner kam je auf die Idee, solche Aufgaben nicht zu erfüllen. Hätten meine älteren Geschwister sich geweigert zu kochen, wenn meine Mutter aus irgendeinem Grund weg war, wären wir Jüngeren ohne Essen geblieben. Weil ich der Sechste von neun war, stellten meine älteren Brüder und Schwestern mehr oder weniger die gleiche Autorität für mich dar wie meine Eltern. Als ein jüngeres Kind in Dublin aufzuwachsen bedeutete für mich, dass praktisch jeder, den ich kannte, mir Anweisungen erteilen konnte. Damals wäre es mir nicht eingefallen, einer Aufforderung von einem Nachbarn oder Älteren nicht zu gehorchen. Wie viele Kinder erinnere ich mich noch, wie unendlich viel größer und selbstbewusster meine älteren Geschwister mir vorkamen. Sie schienen immer zu wissen, was ich gerade dachte und was ich tun oder wovor ich mich drücken wollte. Sie schienen alle Antworten auf meine Fragen zu haben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr ich mich danach sehnte, erwachsen zu werden.
Als ich ins schreckliche Teenageralter kam, hatte unsere Familie sich verändert. Sie konnte es sich leisten, mich als erstes Kind bis zum Abitur in der Schule zu lassen. Meine fünf älteren Geschwister waren bereits verheiratet, als ich sechzehn wurde und mein finanzieller Beitrag war nicht mehr erforderlich. Dadurch war ich der erste, der das Geld, das er mit verschiedenen Nebenjobs verdiente, behalten durfte. Der Vorteil war, dass ich Geld in der Tasche hatte, aber im Rückblick wird mir klar, dass ich auch der erste in der Familie war, dessen Kindheit bis zum Ende der Teenagerzeit andauerte. Heute ist es ganz normal, bis in die späten Zwanziger zu studieren und so von Zuwendungen der Eltern abhängig zu bleiben. Es könnte aber auch dazu führen, dass junge Leute das Gefühl entwickeln, keinen eigenen Beitrag zum Unternehmen Familie zu leisten. In meinem Fall wurde ich vor diesem Leiden dadurch bewahrt, dass jeden kalten Wintermorgen, wenn das Auto meines Vaters nicht ansprang, mein Einsatz gefragt war. Ich muss zugeben, dass ich laut fluchte, wenn meine Mutter in eisigen Wintern in mein Zimmer kam und mich mit den Worten aus dem Schlaf riss: „Steh auf, Lorcan! Dein Vater braucht einen zum Anschieben.”
[Seite 17] Wirkliche Gewissheit, dass ich als ein Mitglied in der Hierarchie geachtet wurde, erhielt ich, als ich
18 wurde. „Dein jüngerer Bruder möchte mit dir reden“, sagte meine Mutter. „Kannst du dir etwas
Zeit für ihn nehmen?“ Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich plötzlich war, als endlich jemand
meinen Rat suchte. Das Problem, um das es ging, war einfach. Ein 16 Jahre alter Junge tyrannisierte
seit längerem meinen 14jahrigen Bruder. Er wollte von mir wissen, wie er das Problem lösen konnte.
Und ich gab ihm den Rat, den jeder verantwortungsbewusste Achtzehnjährige unter solchen Umständen
geben würde. Ich sagte meinem Bruder, er sollte sich einen Stock suchen, sich in den Hinterhalt
legen, bis der Junge vorbei kam und ihm dann von hinten eins überbraten. Das würde die nötige
erzieherische Wirkung haben. (Vor einigen Jahren erinnerte mich mein Bruder daran. Er hatte meinen
Rat genauestens und mit dem erwünschten Ergebnis befolgt.)
Wirkliche Gewissheit, dass ich als ein Mitglied in der Hierarchie geachtet wurde, erhielt ich, als ich
18 wurde. „Dein jüngerer Bruder möchte mit dir reden“, sagte meine Mutter. „Kannst du dir etwas
Zeit für ihn nehmen?“ Ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich plötzlich war, als endlich jemand
meinen Rat suchte. Das Problem, um das es ging, war einfach. Ein 16 Jahre alter Junge tyrannisierte
seit längerem meinen 14jahrigen Bruder. Er wollte von mir wissen, wie er das Problem lösen konnte.
Und ich gab ihm den Rat, den jeder verantwortungsbewusste Achtzehnjährige unter solchen Umständen
geben würde. Ich sagte meinem Bruder, er sollte sich einen Stock suchen, sich in den Hinterhalt
legen, bis der Junge vorbei kam und ihm dann von hinten eins überbraten. Das würde die nötige
erzieherische Wirkung haben. (Vor einigen Jahren erinnerte mich mein Bruder daran. Er hatte meinen
Rat genauestens und mit dem erwünschten Ergebnis befolgt.)
CLAN
Vor vier Jahren feierte meine Mutter ihren 80. Geburtstag. Etwa 250 Leute aus 17 Ländern waren anwesend, alle irgendwie miteinander verwandt. Es war schön, die Kinder und Enkel meiner Cousins und Cousinen aus Kalifornien und Australien zu treffen und Familienähnlichkeiten in Menschen zu entdecken, die sich nie gesehen hatten und auf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen waren. Ich gebe zu, dass solche großen Ereignisse eine Ausnahme sind und der Begriff Familienclan sich im engeren Sinne hauptsächlich auf uns neun Geschwister, unsere Ehepartner, 27 Kinder mit Ehepartnern und deren Kinder bezieht - inzwischen sechs. Nur unmittelbare Familienangehörige waren vor kurzem bei den Hochzeiten meiner Nichten in Kanada und Irland anwesend, etwa 130 Leute. Bei solchen Anlässen werden Gäste wie die deutschen Flynns, meine ugandische Schwiegermutter und andere „Ausländer“ von Familienmitgliedern in Dublin, Perth oder Toronto untergebracht. Die Gastfreundschaft ist selbstverständlich und echt. Einladungen für Gegenbesuche werden ausgetauscht, und die Abschiede ziehen sich stark in die Länge. Ohne diese wunderbare, selbstverständliche Gastlichkeit würde das Clangefühl zweifellos verschwinden. Möge es noch lange leben.
ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT
Vor einigen Jahren hielt ein bekannter irischer Politiker eine Rede in der vollbesetzten Bar des Irischen Zentrums in Brampton, Kanada, wo mein Bruder der Sekretär des Vorstands ist
Er erzählte meinem Bruder, dass die meisten Europäer, wenn sie sich irgendwo auf dem Globus niederließen, als erstes ein Fort und dann ein Gefängnis errichteten. Die Iren waren da anders: Sie bauten meistens als erstes einen Pub, eine Kneipe. Warum? Natürlich ist einer der Gründe, warum die Iren nie eine Kolonie gründeten, der, dass wir selber eine waren, eine britische. Obwohl sich Irland heute eines beachtlichen wirtschaftlichen Erfolgs erfreut, gibt es immer noch das Gefühl „wir gegen die Anderen“, das heißt die unbewusste Überzeugung, dass wir nicht überleben können, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Betritt ein Ire irgendwo auf der Welt einen irischen Pub, wird er immer ein offenes Ohr finden und Informationen erhalten, wo er Arbeit oder Unterkunft bekommen kann. Was würde es uns wohl kosten, wenn alle Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft sich ebenso als eine große Familie betrachteten? Müssen wir wirklich erst von Außerirdischen angegriffen werden, bevor wir erkennen, dass wir alle in einem Boot sitzen?
Übrigens: Da ich ein Mann der Tat bin, war meine Antwort auf die Frage meiner Frau: „Okay, fangen wir an.“
Man sollte sich einmal bewusst machen, wie leicht wir am Arbeitsplatz ersetzbar wären, wenn wir
morgen nicht mehr lebten. Die Familie, die wir hinterlassen, wird den Verlust für den Rest ihres
Lebens fühlen. Warum also stecken wir mehr Energie in unsere Arbeit als in unsere eigene Familie?
- Lorcan Flynn
- Englischlehrer
- Geschichtenerzähler
- Autor
Übersetzung: Roland Greis
Bilder: Lorcan Flynn
Positive Emotionen sind die Motoren des Lebens[Bearbeiten]
VOM UMGANG MIT „SCHWIERIGEN“ KINDERN
VERHALTENSMODIFIKATION ALS METHODE
- Immer auf das Gute blicken
- und nicht auf das Schlechte
- 'Abdu'l-Bahá
In allen großen Religionen erscheint dieser Satz als Gebot.
Viele Menschen halten ihn für ein hohes Ideal, das man im alltäglichen Leben nur sehr schwer verwirklichen kann. Unter dem Blickwinkel der Lernpsychologie und der Familientherapie bekommt dieses Gebot eine völlig neue, sehr praktische und ungeheuer erfolgversprechende Bedeutung.
Die Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Monique Forest-Lindemann beschreibt die Umsetzung, lässt betroffene Eltern zu Wort kommen und erläutert den Weg der Verhaltensmodifikation.
FALLBEISPIEL TIM, BESCHRIEBEN VON DER MUTTER, SZENE ETWA ZEHN MONATE ZUVOR:
Vor kurzem wußte ich weder aus noch ein. Ich war verzweifelt und ratlos. Mein 3 1/2 jähriger Sohn schrie und tobte. Es waren richtige Wutanfälle. Immer aus nichtigem Grund, und immer ganz plötzlich. „Das ist ganz normal“, sagten andere Eltern, „das sind Phasen, die vorbei gehen.” Mein Sohn hatte wieder einmal einen seiner Anfälle. Ich redete beruhigend auf ihn ein, versuchte ihn zu streicheln, zu halten. Er wehrte sich. Ich weinte erst, dann kam die Wut. Ich schrie ihn an. Dann weinte ich wieder. Dann überlegte ich: Ist er überhaupt normal? Er kann nicht normal sein. Das hier ist auf keinen Fall normal. Wahrscheinlich stimmt mit seinen Genen etwas nicht. Was passiert hier? Ich wußte keine Lösung. Ich versuchte es mit Bach-Blüten-Notfall-Tropfen, ich versuchte es mit der Festhalte-Therapie. Es half nichts. Er schrie aus Leibeskräften.
Ich fing an mir vorzustellen, dass ich mein Kind vielleicht weggeben müsste, weil ich irgendwann nicht mehr mit ihm fertig werden würde: früher eine völlig unbegreifliche Vorstellung. Die Schwierigkeiten häuften sich, täglich, bald mehrmals täglich. Er wollte nicht aus dem Auto steigen, wollte abends nicht ins Bett, wollte sowieso nur bei mir im Bett schlafen, wollte nicht essen, was ich gekocht hatte. Er war gegen alles. Er machte alles, wovon ich als noch Kinderlose gesagt hatte: „So etwas würde mein Kind nie tun.” Mein Sohn stellte ununterbrochen wechselnde, unerfüllbare Bedingungen. Ich war seelisch und körperlich mit meinen Kräften am Ende. Mein kleines süßes Kindchen war mein grausamer, ausdauernder Chef und ich die Sklavin.
Es begann gleich nach der Geburt. Man sagte mir: „Wenn dein Kind schreit, hat es wahrscheinlich Hunger, also stille es. Das leuchtete mir ein. Ich stillte also 13 Monate lang Tag und Nacht alle eineinhalb Stunden. Jedes Kind hat ja angeblich seinen eigenen Rhythmus. So lernte das kleine Wesen von seiner ersten Stunde an, dass es nur brüllen muss, damit die Mama kommt.
Familientreffen? Fehlanzeige. Kochen? Nur mit Babysitter. Schon mittags war ich vollkommen erschöpft. Telefonieren? Nur wenn mein Sohn schlief. Wenn ich ein wichtiges Telefonat führen musste, brauchte ich einen Babysitter. Ich muss öfter wichtige Telefonate führen, da ich zuhause selbständig arbeite, seit ich ein Kind habe.
Ich bin inzwischen alleinerziehend. Der Vater gab mir an allem die Schuld. Diese zusätzliche Belastung konnte ich nervlich nicht auch noch aushalten. Er zog aus, als unser Sohn neun Monate alt war.
[Seite 19] Eines Tages hörte ich von den Erfolgen einer Psychologin mit einer
schwierigen Familie. Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr, weil ich wußte, wie
langwierig Therapien meistens sind: Bis sich der
Erfolg einstellen würde, wäre mein Kind erwachsen
und schwer erziehbar oder vielleicht sogar kriminell.
Ich brauchte sofort Hilfe, auf der Stelle. Und wirken
musste sie, sonst wären ich und vor allem mein
Sohn verloren, das war mir klar.
Eines Tages hörte ich von den Erfolgen einer Psychologin mit einer
schwierigen Familie. Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr, weil ich wußte, wie
langwierig Therapien meistens sind: Bis sich der
Erfolg einstellen würde, wäre mein Kind erwachsen
und schwer erziehbar oder vielleicht sogar kriminell.
Ich brauchte sofort Hilfe, auf der Stelle. Und wirken
musste sie, sonst wären ich und vor allem mein
Sohn verloren, das war mir klar.
NACH ACHT MONATEN TRAINING IN VERHALTENSMODIFIKATION
Wir haben Besuch. Tim rennt gleich voraus: „Wer will mein Kinderzimmer sehen?“ Er gibt den Kindern seine Spielsachen. Heute morgen hat er sich allein angezogen. Er hat dabei gesungen und war fröhlich, er ging dann in sein Zimmer und spielte, bis ich aufwachte. Das macht er jetzt jeden Morgen. Wenn ich vergesse, ihn zu loben, sagt er: „Das habe ich toll gemacht, nicht?“ Er ist seit einem halben Jahr im Kindergarten. Anfangs war er ganz außen vor, machte nirgends mit. Die Erzieherinnen sagten: „Er ist halt ein Einzelgänger, das gibt es immer wieder.“ Ich bin inzwischen der Ansicht, dass „Einzelgänger sein” ein Alarmzeichen ist. Jetzt macht Tim im Kindergarten öfter mit. Heute hat er mir beim Gemüseschneiden geholfen, ich habe ihn sehr gelobt, und er war sehr stolz. Er hat sein ganzes Mittagessen aufgegessen. Er ist viel positiver, entspannter, fröhlicher, rundum glücklicher geworden. Er lacht, spielt, singt, erfindet Lieder. Abends meckert er manchmal noch ein bisschen, wenn er ins Bett soll, aber es ist alles ganz anders. Er bleibt im Bett und singt oder erzählt seinen Kuscheltieren eine Geschichte. Das ist für mich ein kleines Wunder. Es gab zwischendurch Rückschläge, denn sobald ich mich nicht strikt an die Lerngesetze halte, ist es erst einmal vorbei mit dem Frieden. Aber ich sehe langsam wieder Land. Ich sehe jetzt einen wirkungsvollen, gewaltfreien Weg, der zwar anstrengend, aber begehbar ist. Ich habe gelernt, dass es zwei elementare Lerngesetze gibt:
1. Ein Verhalten, das beachtet wird, wird wiederholt.
2. Ein Verhalten, das kontinuierlich ignoriert wird, hat die Tendenz zu erlöschen.
Der Weg von der Theorie zur Praxis ist ohne professionelle Hilfe kaum möglich. Die Prinzipien zu verstehen ist einfach, aber es ist sehr schwer, die eigenen Verhaltensmuster dauerhaft zu durchbrechen. Ich beachte mein Kind jetzt positiv für alles mögliche, auch für Selbstverständlichkeiten. Tim freut sich dann immer sehr und ist stolz. Ich versuche, konstant alle Verhaltensweisen zu ignorieren, die ich nicht mehr erleben möchte. Anfangs ist das sehr schwer. Aber der Erfolg zeigt sich überraschenderweise relativ schnell. Das Ignorieren mag hart klingen, aber eine ständig schlechte Beziehung / Stimmung ist erheblich härter und hat verheerende Folgen. Außerdem wird ein Kind durch eine friedliche Art, Grenzen zu erfahren, ausgeglichener. Es wird sicherer und selbstbewusster.
Meistens geschieht das Grenzen setzen negativ emotional, etwa in Wut oder aus Ärger, zu wenig konsequent, ohne Plan. Wenn man willkürlich agiert, verwandelt sich die positive Beziehung Eltern/Kind unmerklich in einen Kampf, in dem es nur Verlierer gibt.
Ich spreche den Tag über immer wieder mit Tim über nette Dinge. Singe und lache mit ihm. Er erzählt und singt jetzt viel und ist gern lustig. Ich versuche, Ermahnungen wegzulassen. Das stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes, weil es merkt: Die Mama traut mir etwas zu. Die Kindergärtnerin fragte mich kürzlich, was ich mit Tim gemacht hätte. Er sei wie ausgewechselt. Dieses ganze Training ist gleichzeitig auch ein Selbstbehauptungstraining. Ich kann mich besser durchsetzen und spüre schon erste Erfolge auch in meinem Berufsleben. Es geht mir viel besser. Dies ist der Stand nach acht Monaten Verhaltensmodifikationstraining.
- Verhaltensmodifikation ist eine Hilfe für Eltern mit dem Ziel, ein emotionales Gleichgewicht beim Kind zu schaffen, damit es sich normal entwickelt. Die optimale Förderung findet statt, wenn das Kind im Alltag positive Beachtung von den Bezugspersonen bekommt. Es erlebt dann positive Emotionen und fühlt sich wohl, fröhlich und selbstsicher.
Die Verhaltensmodifikation ist eine friedliche erzieherische Methode und basiert auf
der wissenschaftlichen Lernpsychologie. Verhaltensweisen, erwünschte wie unerwünschte,
werden unter Einflüssen des Umfeldes erlernt. Bei dieser Methode werden die beiden oben
genannten Lerngesetze berücksichtigt und im Alltag umgesetzt.
Die Absicht der Eltern ist aufrichtig: Sie möchten beim Kind nur erwünschte Verhaltensweisen sehen, dennoch ist die negative erzieherische Methode nicht nur erfolglos, sondern verursacht eine emotionale Blockierung beim Kind, das immer öfter Unlust und Opposition zeigt. Daher übt Tims Mutter, ihm positive Beachtung zu geben, und zwar für „selbstverständliche“ Verhaltensweisen wie sich anziehen, waschen, sich beschäftigen, mit einem kleinen Freund spielen, essen, malen.
Das ist der Hauptansatz der Verhaltensmodifikation: Die Eltern üben in alltäglichen Situationen, dem Kind mehr positive Beachtung zu geben. Dadurch rufen sie beim Kind und bei sich selbst positive Emotionen hervor, und allmählich wird eine positive Beziehung zwischen Eltern und Kind aufgebaut. Nur so kann ein Kind emotional stabil werden und sich normal entwickeln. Die negative Beachtung verursacht eine emotionale Blockierung beim Kind, das unsicher, unruhig, zappelig, unkonzentriert, oppositionell wird. Es kann sich nicht harmonisch entwickeln. Daher findet das Training in Verhaltensmodifikation in erster Linie mit den Bezugspersonen statt.
VERHALTENSANALYSE
Obwohl die Bezugspersonen es gut meinen, verstärken sie durch negative Beachtung genau die unerwünschten Verhaltensweisen des Kindes. Es lernt, für unerwünschte Verhaltensweisen Beachtung zu bekommen. Die kommt aber überwiegend als Aufforderung, Ermahnung, Kritik, Schimpfen, Strafen und gelegentliches Schlagen, daher wird das Kind oppositionell, unruhig, unkonzentriert, zappelig und auch aggressiv. Seine erwünschten Verhaltensweisen werden meistens als selbstverständlich betrachtet und deshalb ignoriert. Konsequenterweise zeigt das Kind immer weniger erwünschte Verhaltensweisen. Die Beziehung Eltern/Kind verschlechtert sich.
Aufgrund der wachsenden negativen Beachtung erlebt das Kind immer wieder negative Emotionen, die hemmende Effekte hervorrufen und die kindliche Entwicklung beeinträchtigen. Peu a peu verliert das Kind jegliche Motivation zu kooperieren. Konzentration und Aufmerksamkeit werden schwächer, Opposition und Unruhe nehmen zu.
DIAGNOSE
Umfeldbedingte Verhaltensauffälligkeiten mit Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens
THERAPIEZIEL UND TRAINING DER BEZUGSPERSONEN ZUR VERHALTENSMODIFIKATION
Es geht darum, erwünschte Verhaltensweisen beim Kind positiv zu beachten und unerwünschte Verhaltensweisen zu ignorieren. Die Umsetzung dieser Grundsätze in alltäglichen Situationen verlangt einen aktiven Lernprozess von den Bezugspersonen, der in sechs Schritten abläuft.
1. Beobachtung der eigenen Verhaltensweisen
In der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens als Reaktion auf Verhaltensweisen ihres Kindes stellen die Bezugspersonen fest, dass sie dem Kind für unerwünschtes Verhalten negative Beachtung geben und dass sie kaum seine „normalen“ erwünschten Verhaltensweisen sehen und positiv beachten.
[Seite 21] 2. Benennung der vorhandenen „normalen“ Verhaltensweisen
2. Benennung der vorhandenen „normalen“ Verhaltensweisen
Die zahlreichen Schwierigkeiten mit dem Kind führen bei den Bezugspersonen zu einer grundsätzlich negativen Wahrnehmung des Kindes, obwohl es gelegentlich ein „normales“ Verhalten zeigt. Hier muß man die vorhandenen „normalen“ oder „selbstverständlichen“ Verhaltensweisen des Kindes sehen, benennen und wahrnehmen. Anwendbare positive soziale Verstärker wie zum Beispiel sich selbst fröhlich zeigen, das Kind nett anschauen, sich mit ihm unterhalten, mit ihm beschäftigen, loben, mit ihm schmusen und ähnliches werden identifiziert.
3. Umsetzung der Lerngesetze im Alltag
Der Schwerpunkt des Trainings liegt darin, erwünschte Verhaltensweisen durch die Anwendung der positiven Beachtung (Mimik, Gestik, Körperkontakt, Aussagen) zu bestätigen und unerwünschte zu ignorieren. Das verlangt von den Bezugspersonen ein tägliches bewusstes Üben. Sie lernen ihre eigenen Verhaltensweisen zu steuern und nicht mehr impulsiv zu handeln. Eine kognitive Kontrolle findet statt, indem sie sich fragen: „Will ich dieses Verhalten nochmals erleben?“ Wenn ja, dann geben sie positive Beachtung. Wenn nein, ignorieren sie das Verhalten des Kindes. Dieser Lernprozess ist mühsam und lang, abhängig davon, wie intensiv die Bezugsperson sich bemüht. Die neuen Verhaltensweisen werden so lange geübt, bis sie automatisiert, zu Gewohnheiten geworden sind. Es wird gelernt, auf wiederholte Erklärungen, Aufforderungen, Befehle, Ermahnungen zu verzichten und in einer ruhigen und angenehmen Tonlage miteinander zu sprechen. Parallel ist eine Kooperation mit den Kindergärtnerinnen erforderlich.
4. Gestaltung des Alltagsablaufs
Die Eltern gestalten einen altersentsprechenden und fröhlichen Alltag ohne Aufforderungen, Ermahnungen oder negative Kritik. Der emotionale Druck wird abgebaut, denn er erzeugt psychischen Gegendruck. Die Anwesenheit der Bezugspersonen im Alltag ist notwendig, um die Beziehung zum Kind aufzubauen. Die Freizeitaktivitäten werden neu gestaltet. Hier geht es meistens darum, den elektronischen Konsum einzuschränken und statt dessen an sinnvollen Beschäftigungen oder an Gruppenaktivitäten teilzunehmen.
5. Konsequentes Handeln
Die Bezugspersonen üben, sich selbst an die Regeln zu halten. Sie lernen auch natürliche Folgen eines Verhaltens zu berücksichtigen. Nach und nach werden die Grenzsetzungen wirksam, da das Kind durch die Anwendung der positiven Beachtung erst in die emotionale Lage versetzt wird, selbst zu wollen und die Regeln zu akzeptieren. Die verbalen Grenzsetzungen können niemals als einzige Maßnahme wirken.
6. Generalisierung der Verhaltensmodifikation
Die Bezugspersonen wenden die Verhaltensmodifikation bei allen Mitgliedern der Familie oder der Gruppe an. Auch innerhalb der Partnerschaft wird der positive Einsatz der Verhaltensmodifikation geübt.
EFFEKTE DER VERHALTENSMODIFIKATION
Bei überwiegend positiver Beachtung für erwünschte Verhaltensweisen zeigt das Kind allmählich mehr davon. Gleichzeitig führt das Ignorieren der unerwünschten zu deren Erlöschen. Durch die positive Beachtung der Eltern wird die Eltern/Kind-Beziehung aufgebaut. Das Kind zeigt allmählich seinen Eltern gegenüber Vertrauen, es sucht den Kontakt. Die Zuwendung, die es von ihnen bekommt, gibt es zurück. Ein positiver Kommunikationskreislauf kommt in der Familie in Gang. Es findet eine Identifikation mit den Eltern statt, was den Lernprozess durch Nachahmung der erwünschten Verhaltensweisen der Eltern ermöglicht. Außerdem steigen bei erhöhter positiver Beachtung Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl beim Kind. Es wird emotional stabiler, ruhiger und ausgeglichener.
Motivation, Konzentration, Aufmerksamkeit und Kooperationsbereitschaft steigen deutlich.
Das Kind beschäftigt sich öfter länger bei Spiel-, Mal-, und Bastelaktivitäten. Seine
sensorischen Wahrnehmungen, seine Fein- und Grobmotorik werden adäquater. Das Kind hat
Erfolgserlebnisse. Es erwirbt soziale Kompetenzen. Es ist nicht mehr isoliert, es hat
Freunde. Es kopiert die erwünschten Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen, die es
[Seite 22] täglich beobachtet und erlebt. Es pflegt altersentsprechende Tätigkeiten und nimmt
gelegentlich an Freizeitgruppenaktivitäten teil. Die Unsicherheit, Unruhe, Zappeligkeit,
die Opposition gehen zurück. Das Kind traut sich mehr zu und zeigt sich unternehmungslustig.
Es ist selbstbewusst geworden. Die Harmonie überwiegt in der Familie, die inzwischen ein
zufriedenstellendes Familienleben führt.
täglich beobachtet und erlebt. Es pflegt altersentsprechende Tätigkeiten und nimmt
gelegentlich an Freizeitgruppenaktivitäten teil. Die Unsicherheit, Unruhe, Zappeligkeit,
die Opposition gehen zurück. Das Kind traut sich mehr zu und zeigt sich unternehmungslustig.
Es ist selbstbewusst geworden. Die Harmonie überwiegt in der Familie, die inzwischen ein
zufriedenstellendes Familienleben führt.
Die Verhaltensmodifikation ist in jeder Altersstufe erfolgreich anwendbar, aber je jünger das Kind ist, desto leichter ist sie. Ein positives Umfeld beeinflusst direkt das Erwerben von erwünschten Verhaltensweisen beim Kind. Je früher die Bezugspersonen lernen, positiv mit dem Kind umzugehen, desto leichter wird die Aufgabe „Erziehen“ und desto „normaler“ und fröhlicher entwickelt sich das Kind.
- Monique Forest-Lindemann
QUELLENANGABEN
- Bippuuph, S. (1997) Das GEHEIMNIS GLÜCKLICHER KINDER. MÜNCHEN: BEUST
- Bora-Laufs, M. (2001). VERHALTENSTHERAPIE MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN. TÜBINGEN: DGYT
- Dreikurs, R., LOREN, G. (1991). KINDER LERNEN AUS FOLGEN. FREIBURG: HERDER
- GEBAUER, K, HÜTHER, G. (2003). KINDER BRAUCHEN WURZELN. DÜSSELDORF: WALTER
- Goleman, D. (1995). EMOTIONALE INTELLIGENZ. MÜNCHEN: DTV
- Hüther, G., Bonney, H. (2002). NEUES VOM ZAPPELPHILIPP. DÜSSELDORF: WALTER
- Kast-Zahn, A. (1997). JEDES KIND KANN REGELN LERNEN. RATINGEN-LINTORF: OBERSTEBRINK
- Krowatschek, D. (2002). ALLES ÜBER ADS. EIN RATGEBER FÜR ELTERN UND LEHRER. DÜSSELDORF: WALTER
- Sulz, S., Heekehrens, H.-P.(Hrsg) (2002). FAMILIEN IN THERAPIE. GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG KOGNITIV-BEHAVIORALER FAMILIENTHERAPIE. MÜNCHEN: CIP-MEDIEN
- Voss, R., Wirtz. R. (2000). KEINE PILLEN FÜR DEN ZAPPELPHILIPP. HAMBURG: RORORO
Fotos: M. Willems
Die ersten Jahre sind die wichtigsten[Bearbeiten]
PRÄGUNG IM KINDESALTER / DIE WIRKUNG VON GENETISCHEN ANLAGEN UND UMWELTEINFLÜSSEN
Prägung bedeutet Formgebung. Die maßgebliche Prägung des Menschen findet während seiner
Kindheit statt, und man weiß heute, dass dafür die ersten drei bis fünf Lebensjahre
entscheidend sind. Prägung auf den Menschen bezogen bedeutet, dass er in seinen ersten
Lebensjahren eine bestimmte Form erhält. Doch welche Faktoren geben dem Menschen eine Form?
Ist dieser Prozess umkehrbar? Wie verläuft die Entwicklung des Menschen? Welchen Einfluss
hat die Erziehung auf diesen Prozess? Die Wissenschaft ist seit jeher bemüht, ein besseres
Verständnis der menschlichen Daseinsebenen zu entwickeln und dementsprechend die dem Menschen
innewohnenden Anlagen zu fördern. Bereits Plato und Aristoteles waren der Meinung, dass Kinder
mit bestimmten Begabungen auf die Welt kommen und diese dann ausgebildet werden
müssten. Diesen frühen Erkenntnissen entspricht auch die moderne Wissenschaft. Seit Beginn
des 20. Jahrhunderts gewannen die wissenschaftlichen Untersuchungen der kindlichen Entwicklung
rasch an Bedeutung. Erst durch standardisierte Tests, später durch Säuglings- und
Kleinkindbeobachtungen konnten viele Informationen über kindliche Entwicklungsmuster
sowie -geschwindigkeit gewonnen werden. Deutlich wurde hierbei, dass die Entwicklung
eines Menschen auf drei Ebenen verläuft: auf der körperlichen, der mentalen und der
geistigen.
Die Entwicklung des Menschen ist ein Prozess, der mit der Verschmelzung des elterlichen Chromosomenpaars einsetzt und ein Leben lang dauert. Sie ist ein aufeinander aufbauender Vorgang nach einem bestimmten Muster. Dieses Wachstum erfolgt nicht linear, sondern ist durch sensible und ruhende Phasen gekennzeichnet. Die sensiblen Phasen sind Zeiträume, während derer eine Anlage gegenüber bestimmten Reizen empfindlich reagiert und das Erlernen einer bestimmten Fähigkeit am einfachsten ist. Wird diese prägende Phase übersehen, kann dies bei manchen Fertigkeiten nur sehr schwer nachgeholt werden.
Die heutigen Kenntnisse bestätigen das Zusammenwirken von angeborenen Anlagen und Umwelteinflüssen für die Entwicklung des Kindes. Unter angeborenen Anlagen versteht man die genetische Erbinformation, die dem Kind durch die Chromosomen von seinen Eltern mitgegeben wird und lebenslang konstant bleibt. Die unterschiedlichen Gene werden zu verschiedenen Zeiten aktiv und beeinflussen die menschliche Entwicklung. Zudem ordnet die Wissenschaft dem Menschen folgende Fähigkeiten zu, welche in der übrigen Schöpfung nicht anzutreffen sind:
Zunächst ist der Mensch ein Lernwesen, das heißt, er muß vom ersten Augenblick seines Lebens an lernen, mit den komplizierten und wechselhaften Umständen seiner Umwelt umzugehen und sich anzupassen. Der Mensch hat weiterhin die Möglichkeit, aus Einsicht situationsbedingt zu handeln und sich an Vorbildern, mit denen er sich emotional verbunden fühlt, zu orientieren. Des Weiteren kann er selbst urteilen, zu seinen Instinkten und Trieben Stellung nehmen, darauf reagieren und sie kontrollieren. Er ist ferner in der Lage, innerhalb mehrerer Zeiträume zu denken: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daher hat er im Hinblick auf die Zukunft Gestaltungs- und Änderungsmöglichkeiten.
[Seite 24] Neben der Lern- und Denkfähigkeit ist das Sprechen ein herausragendes Merkmal, was ihn zur
Arterhaltung durch Kommunikation befähigt. Auch der Humor ist als eine dem Menschen spezifische
Eigenschaft anzusehen. Weiterhin kann er ein Gewissen bilden, eine gesellschaftliche Ordnung
aufbauen und sozialen Umgang lernen. Schließlich hat er ein Grundbedürfnis nach Liebe, Glück,
Geborgenheit, Sicherheit, Selbstverwirklichung und Geltung.
Neben der Lern- und Denkfähigkeit ist das Sprechen ein herausragendes Merkmal, was ihn zur
Arterhaltung durch Kommunikation befähigt. Auch der Humor ist als eine dem Menschen spezifische
Eigenschaft anzusehen. Weiterhin kann er ein Gewissen bilden, eine gesellschaftliche Ordnung
aufbauen und sozialen Umgang lernen. Schließlich hat er ein Grundbedürfnis nach Liebe, Glück,
Geborgenheit, Sicherheit, Selbstverwirklichung und Geltung.
Die Umwelteinflüsse unterteilt man in soziale und materielle Einflüsse: Die „soziale Umwelt“ bezieht sich auf andere Menschen, die direkt oder indirekt auf das Kind einwirken. An erster Stelle steht hier in aller Regel die Mutter. Für sie steht auch der Begriff „schützende Umwelt“. Der Vater wirkt während der Schwangerschaft und dem frühen Säuglingsalter primär durch die Unterstützung der Mutter. Ferner spielen Schwangerschaftsverlauf, Geschwisterposition, Familienstatus und das Familienklima eine Rolle. Die „materielle Umwelt“ bezieht sich auf klimatisch-geographische Gegebenheiten sowie auf die Lebensumstände.
Das körperliche Wachstum ist in der Kindheitsphase besonders offensichtlich. Der Mensch beginnt mit einer einzigen Zelle und erreicht innerhalb von neun Monaten ein Gewicht von drei bis vier Kilogramm und eine Länge von etwa 50 Zentimeter. Während der ersten fünf Monate macht das Neugeborene noch einen raschen Wachstumsschub und verdoppelt sein Geburtsgewicht, im ersten Lebensjahr verdreifacht es sich. Den zweiten großen Wachstumsschub gibt es in der Pubertät. Bis etwa zum 30. Lebensjahr findet nur noch ein langsames Wachstum der Muskeln statt. Danach ist das körperliche Wachstum abgeschlossen, künftig muss für den Erhalt des Körpers gesorgt werden.
Die mentale Entwicklung verläuft stetig. Bei seiner Geburt bringt der Säugling kognitive Fähigkeiten (Erkennen, Wahrnehmen) mit. Danach vollzieht sich eine enorme Hirnentwicklung in Form von Nervenzellvernetzungen. Alles, was auf die Sinnesorgane des Säuglings einwirkt, hat Einfluss auf diesen Prozess und die Entwicklung des Gehirns. Zu Anfang sind die Reflexe die sichtbaren Äußerungen des Säuglings. Im Laufe der Zeit lernt er zu lächeln, zu greifen, Laute von sich geben, zu sitzen, zu krabbeln. Mit diesen Funktionen entwickelt und erweitert er seine Fertigkeiten und seinen Horizont. Auch emotionale Impulse wie Liebe, Mitgefühl, Zärtlichkeit und Feinfühligkeit können über Gehirnschaltungen gelernt und geübt werden. Eine Vernachlässigung dieser Impulse im Kindesalter hat dementsprechend eine Verkümmerung dieser Fähigkeiten zur Folge. Im Kindergartenalter kommen schließlich fein koordinierte Bewegungsabläufe hinzu, wie beispielsweise das Knöpfe schließen oder das Schleifen binden; die Merk- und Lernfähigkeit wird den Anforderungen entsprechend optimal ausgebildet. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist das Erlernen von Fremdsprachen. Die Erstsprache wird mühelos mit Hilfe von Bezugspersonen etwa bis zum fünften Lebensjahr gelernt und gesprochen. Die spätere Zweitsprache erreicht selten die Perfektion und das Niveau der Erstsprache. Auch Akzente und die Sprachmelodie der ersten Sprache bleiben zeitlebens erhalten und durchdringen auch später erlernte Sprachen. Interessant ist hierbei auch die Schwierigkeit von Asiaten, die Phoneme „r“ und „l“ akustisch zu unterscheiden. Grund hierfür ist, dass die dazu notwendigen Nervenzellverbindungen im Säuglingsalter mangels akustischer Reize nicht gebildet worden sind. Asiatische Babys, die hingegen im westlichen Raum aufwachsen sind, verfügen über diese Fähigkeit.1) Dieser Prozess schreitet langsam und stetig voran und hält bis zur Pubertät an. Den Höhepunkt der Merkfähigkeit und Aufnahmebereitschaft überschreitet der Mensch mit 30 bis 35 Jahren. Da diese Fähigkeiten jedoch gleichzeitig durch die Erfahrung ergänzt werden, befinden sich alle wichtigen mentalen Funktionen bis ins hohe Alter im Wachstum und enden erst mit dem physischen Ende der Existenz.
Doch nun zur geistigen Entwicklung des Menschen, die für sein Dasein eine ganz besondere Rolle spielt. Der Mensch trägt die Anlagen zu geistigen Fähigkeiten - wie Gerechtigkeit, Liebe, Güte, Demut - in sich. Diese Anlagen müssen aber entwickelt werden. Das ist die Aufgabe der Erziehung. Geistige Entwicklung findet das ganze Leben lang statt.
- „Betrachte den Menschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.“
- Bahá’u’lláh2)
Grundlage der geistigen - gleich seelischen - Entwicklung des Menschen ist die Liebe,
die er im Laufe seiner Entwicklung erfährt. In der wissenschaftlichen Fachsprache wird
Liebe als „Bindung" bezeichnet3), als Grundbedürfnis des Menschen. Bei der Geburt
befindet sich der Säugling in einer Zeit größter Abhängigkeit von seiner Mutter oder der
versorgenden Umwelt. Es ist eine Zeit übermäßiger Empfindsamkeit. Der Säugling registriert
die gute und zuverlässige Erfüllung seiner Wünsche und Bedürfnisse als ein positives
Erlebnis. Er verinnerlicht diese Erfahrung von Liebe, Geborgenheit und Schutz. Er kann
Vertrauen bilden und es entsteht eine „Bindung“, zu sich und zu seiner „Mutter“. Diese
Erfahrung ermöglicht es ihm, in späteren Phasen seines Lebens auch zu anderen Personen
Beziehungen aufzubauen. Säuglinge und Kleinkinder, die in einer sicheren, vertrauensvollen
Atmosphäre und dem liebevollen Klima einer Familie aufwachsen, können sich seelisch davon
ernähren
[Seite 25] und ein Urvertrauen bilden. Sie erleben geistige Werte, wie Liebe, Geduld, Demut, Ehrlichkeit,
Höflichkeit, Zuverlässigkeit. Diese Erfahrungen nimmt das Kind als inneren Wert auf und
integriert sie in sein Leben. Sie werden Teil des Weltbildes, das sein weiteres Leben und
Handeln bestimmt. Bei Kleinkindern besteht großer Forscherdrang. Ein Kind, das sichere
emotionale Bindung kennt, kann diesem Drang gut nachgehen, die Welt erforschen und
eigene Erfahrungen machen. Erlebte Bindung führt zu seelischer Stabilität und Flexibilität,
so dass Lebenskrisen gut bewältigt werden können. Erlebte Bindung versetzt den Menschen
ferner in die Lage, Einfühlungsvermögen zu entwickeln und zwar sowohl in die eigene Person,
als auch in andere Menschen. Vertrauen in andere Menschen kann sich in ein „Vertrauen in Gott“
fortsetzen, also in das, was der Kinderpsychoanalytiker Winnicott D. W. Winnicott als einen
„Glauben an“ bezeichnet. Kinder hingegen, die in ihrem Leben ein ambivalentes Verhalten oder
eine unstete Versorgung durch ihre Eltern erfahren haben, fühlen sich unsicher, trauen
sich nicht, können sich schlecht von den Eltern trennen, obwohl sie sich das wünschen. Es
fehlt ihnen am „Vertrauen ins Leben“. Sie meiden Beziehungen und werden aggressiv.
Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, Essstörungen und viele andere krankhafte
Störungen können weitere Folgen sein.
und ein Urvertrauen bilden. Sie erleben geistige Werte, wie Liebe, Geduld, Demut, Ehrlichkeit,
Höflichkeit, Zuverlässigkeit. Diese Erfahrungen nimmt das Kind als inneren Wert auf und
integriert sie in sein Leben. Sie werden Teil des Weltbildes, das sein weiteres Leben und
Handeln bestimmt. Bei Kleinkindern besteht großer Forscherdrang. Ein Kind, das sichere
emotionale Bindung kennt, kann diesem Drang gut nachgehen, die Welt erforschen und
eigene Erfahrungen machen. Erlebte Bindung führt zu seelischer Stabilität und Flexibilität,
so dass Lebenskrisen gut bewältigt werden können. Erlebte Bindung versetzt den Menschen
ferner in die Lage, Einfühlungsvermögen zu entwickeln und zwar sowohl in die eigene Person,
als auch in andere Menschen. Vertrauen in andere Menschen kann sich in ein „Vertrauen in Gott“
fortsetzen, also in das, was der Kinderpsychoanalytiker Winnicott D. W. Winnicott als einen
„Glauben an“ bezeichnet. Kinder hingegen, die in ihrem Leben ein ambivalentes Verhalten oder
eine unstete Versorgung durch ihre Eltern erfahren haben, fühlen sich unsicher, trauen
sich nicht, können sich schlecht von den Eltern trennen, obwohl sie sich das wünschen. Es
fehlt ihnen am „Vertrauen ins Leben“. Sie meiden Beziehungen und werden aggressiv.
Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, Essstörungen und viele andere krankhafte
Störungen können weitere Folgen sein.
Es ist wichtig zu bemerken, dass diese Fehlentwicklungen umkehrbar sind, wenn auch sehr mühsam. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Minimum an positiver emotionaler Erfahrung.
Zusammenfassend zeigt diese sehr vereinfachte Darstellung der kindlichen Entwicklung zweierlei: Zum einen die Wichtigkeit der „schützenden Umwelt“ - im Idealfall durch die Eltern. Demnach ist es von essentieller Bedeutung, den Familien und hierbei insbesondere den Müttern bestmögliche Förderung und Unterstützung zukommen zu lassen. Eine Mutter, die ihrerseits eine liebevolle Versorgung erfahren hat, kann diese weitergeben. Die Erziehung des Säuglings und Kleinkindes verläuft dann sanft, fast unbemerkt. Es scheint eine Fortsetzung der physiologischen Versorgung im Mutterleib zu sein. Zum anderen wird auch deutlich, wie sehr der Mensch von seinen genetischen Anlagen sowie seiner materiellen und sozialen Umwelt geprägt wird.
Damit allein wird man jedoch dem Wesen des Menschen nicht gerecht. Auch das Göttliche nimmt Einfluss auf die Entwicklung des Menschen. Ein Einfluss, der sich einer gegenständlichen Beschreibung entzieht, da er Teil des göttlichen unbegreiflichen Mysteriums ist:
- „O Sohn des Menschen!
- Verhüllt in Meinem unvordenklichen Sein und in der Urewigkeit Meines Wesens, wusste ich um Meine Liebe zu dir. Darum erschuf ich dich, prägte dir Mein Ebenbild ein und offenbarte dir Meine Schönheit.“
- Bahá’u’lláh4)
- 1) Vgl. auch Prof. W. Singer, WAS KANN EIN MENSCH WANN LERNEN?
- 2) Ährenlese 122
- 3) Vgl. Leisig, „BINDUNG UND BINDUNGSTHEORIE"
- 4) VERBORGENE WORTE AUS DEM ARABISCHEN, NR. 3
Dr. med. Mina Weisser
- geboren im Iran
- Studium der Medizin in München
- nach Abschluss der Facharztausbildung
- als Mutter, Hausfrau und
- Kinderärztin in eigener Praxis tätig
Fotos: ROLAND GREIS
Kinder wollen und können Verantwortung übernehmen[Bearbeiten]
Rechte und Pflichten von Kindern in der Familie
„Nach den Lehren Bahá’u’lláhs soll die Familie als eine menschliche Einheit nach
den Regeln der Heiligkeit erzogen werden. Alle Tugenden sind der Familie zu lehren.
Die Familienbande sind unversehrt zu bewahren; die Rechte der Familienmitglieder
dürfen nicht verletzt werden, weder die des Sohnes noch die des Vaters oder der
Mutter. Niemand darf rücksichtslos sein. Wie der Sohn bestimmte Pflichten gegenüber
dem Vater hat, so hat der Vater Pflichten gegenüber dem Sohn. Die Mutter, die
Schwester und die anderen Haushaltsmitglieder haben ihre eigenen Vorrechte. Alle
diese Rechte müssen gewahrt werden, doch die Einheit der Familie muss erhalten
bleiben.”1)
Die Familie ist eine Einheit. Die Gerechtigkeit, von Bahá’u’lláh so sehr betont - „Von allem das Meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit...” 2) - verlangt, dass die Rechte und Pflichten der verschiedenen Familienmitglieder in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, und die Rechte der Einzelnen mit den Bedürfnissen der Familie als Ganzes ausbalanciert werden müssen, so dass auf dieser Grundlage die Einheit der Familie besteht.
Welches sind nun die Rechte und Pflichten der Kinder? Im juristischen Sinne sind die Rechte der Kinder festgeschrieben in der „UN-Konvention über die Rechte des Kindes“, die jeder vernünftige Mensch nur unterschreiben kann (und zugleich beklagen, dass vielerorts die Umsetzung dieser Konvention problematisch ist, und dass so vielen Kindern überall auf der Welt diese Rechte vorenthalten werden). Über die Pflichten der Kinder dagegen gehen die Meinungen auseinander, und in nicht wenigen Familien sind sie Anlass für Konflikte. Welches Licht werfen die Bahá’í-Schriften auf dieses Thema?
Die Lebensaufgabe des Kindes - sein Recht und seine erste „Pflicht“ - ist es, zu wachsen,
sich zu entwickeln, die in ihm angelegten Fähigkeiten zu entfalten, seine „Edelsteine ans
Licht zu bringen“.3) Dafür ist es angewiesen auf die Liebe und die
Fürsorge seiner Eltern. So hat es der Schöpfer dem Menschen bei seiner Erschaffung
bestimmt: „O Sohn der Großmut! Aus den Wüsten des Nichtseins formte Ich dich durch
den Lehm Meines Befehls. Ich befahl allen Atomen des Seins und dem Wesen alles
Erschaffenen, dich zu erziehen. Noch ehe du aus deiner Mutter Schoß entbunden
warst, bestimmte Ich dir zwei Quellen heller Milch, Augen, über dich zu wachen,
und Herzen, dich zu lieben...”.4) Das Kind hat ein Recht auf die
unbedingte, die
[Seite 27] voraussetzungslose Liebe seiner Eltern. Und das Kind hat ein Recht auf Erziehung.
Denn nur durch Erziehung kann es seine Anlagen entfalten „Betrachte den Menschen
als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung
kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu
ziehen vermag."5) „...es ist die Pflicht der Eltern, ihre Kinder
vollkommen und sorgsam zu erziehen".6)
voraussetzungslose Liebe seiner Eltern. Und das Kind hat ein Recht auf Erziehung.
Denn nur durch Erziehung kann es seine Anlagen entfalten „Betrachte den Menschen
als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung
kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu
ziehen vermag."5) „...es ist die Pflicht der Eltern, ihre Kinder
vollkommen und sorgsam zu erziehen".6)
Umgekehrt haben die Kinder die Pflicht, den Eltern „Achtung und Ehrfurcht“ zu erweisen. Wenn die Kinder selber erwachsen werden, sollen sie aus Dankbarkeit den Eltern gegenüber „fürsorglich und wohltätig sein und um Vergebung und Verzeihung für ihre Eltern flehen”7), also für die Eltern beten:
- O Herr! In dieser größten Sendung nimmst Du die Fürbitte der Kinder für ihre Eltern an. Dies ist eine der besonderen, unendlichen Gnadengaben dieser Sendung. Nimm deshalb, o Du gütiger Herr, die Bitte Deines Dieners an der Schwelle Deiner Einzigkeit an und lasse seinen Vater versinken im Meere Deiner Gnade. Denn dieser Sohn hat sich erhoben, Dir zu dienen, und müht sich unentwegt auf dem Pfade Deiner Liebe. Wahrlich, Du bist der Gebende, der vergebende und der Gütige.8)
„Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben.
Dann wird Gottes Ruf erschallen: »Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine
Eltern erbeten hast!« Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache
hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen, dem vielgeliebten “ 9) Sie
sollen ihnen Hilfe leisten, vor allem, wenn sie alt und krank werden: „Erweist euren Eltern
Achtung und Ehrfurcht... Als Wir von deiner Mutter Leid erfuhren, wiesen Wir dich an, zu
ihr zurückzukehren... Vor die Wahl gestellt, Mir einen Dienst zu erweisen oder ihnen, dient
lieber ihnen und lasst solches Dienen einen Pfad sein, der herführt zu Mir.”10)
Für ihre Heirat haben sie die Pflicht, das Einverständnis ihrer Eltern einzuholen.
Das sind explizite Pflichten der erwachsenen Kinder ihren Eltern gegenüber. Wie aber sieht es mit Pflichten der Kinder aus, solange sie noch nicht erwachsen sind? Was bedeutet im Kindesalter „Achtung und Ehrfurcht“ vor den Eltern oder „Gehorsam“ gegen die Eltern? Und wie steht es mit Pflichten der Kinder innerhalb der Familie, mit Pflichten im Haushalt? Knüpfen wir an das oben Gesagte an: Erste Aufgabe eines Kindes ist sein eigenes Wachstum, die Entwicklung der in ihm angelegten Fähigkeiten. Dafür braucht es Erziehung. Was bedeutet Erziehung? Bahá’u’lláh schreibt: „So jemand seinen Sohn oder den Sohn eines anderen aufzieht, ist es, als erzöge er einen Meiner Söhne.“ Das bedeutet, dass Kinder nicht den Eltern gehören, wie es in einem Gedicht Khalil Gibrans heißt
- Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
- Sie sind die Söhne und Töchter der
- Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
- Sie kommen durch euch,
- aber nicht von euch.
- Und obwohl sie mit euch sind,
- gehören sie euch doch nicht.
- Ihr dürft ihnen eure Liebe geben,
- aber nicht eure Gedanken
- Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben,
- aber nicht ihren Seelen.
- Denn ihre Seelen wohnen
- im Haus von morgen,
- das ihr nicht besuchen könnt,
- nicht einmal in euren Träumen.
- Ihr dürft euch bemühen wie sie zu sein,
- aber versucht nicht,
- sie euch ähnlich zu machen.11)
Sondern sie sind ihnen anvertraut als etwas ganz besonders Kostbares, für das sie im
Auftrag des Schöpfers die verantwortungsvolle Aufgabe Übernehmen dürfen, sie so
zu erziehen, als erzögen sie „einen Meiner Söhne“.
Erziehung bedeutet nicht, Kinder wie Wachs zu formen oder wie leere Gefäße zu
füllen und erst zu Menschen „zu machen“. Denn Kinder werden geboren als Menschen
gleich einem „Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert“ und verdienen
den Respekt und die Wertschätzung der Erwachsenen als Gleichwürdige. Jedes
Kind besitzt seine eigenen Fähigkeiten und
[Seite 28] hat seinen eigenen Weg vor sich. Und es hat das Recht darauf, die persönliche
Verantwortung für sich selbst zu tragen, denn „Jeder von uns hat nur ein einziges
Leben zu verantworten, und das ist sein eigenes..." 12)
hat seinen eigenen Weg vor sich. Und es hat das Recht darauf, die persönliche
Verantwortung für sich selbst zu tragen, denn „Jeder von uns hat nur ein einziges
Leben zu verantworten, und das ist sein eigenes..." 12)
Traditionell haben Erwachsene ihre Erziehungsaufgabe sehr oft so verstanden, dass sie Kindern die persönliche Verantwortung abgenommen haben. Sie meinten zu wissen, wann das Kind hungrig ist, wie viel es essen muss oder was ihm gut schmeckt („Noch einen Löffel für die Oma... Spinat schmeckt doch sooo gut!”).
Neuere Forschungen über Säuglinge und Kleinkinder 13) haben jedoch gezeigt, dass Kinder in mehreren Lebensbereichen von Anfang an die persönliche Verantwortung für sich selbst Übernehmen können, so für ihre Sinneswahrnehmungen (zum Beispiel was gut schmeckt oder nicht), für ihre Gefühle (Freude, Liebe, Zorn, Frustration, Trauer, Schmerz, Lust) und für ihre Bedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf, Nähe, Distanz). Dass die Eltern ihnen die Möglichkeit geben, ihre persönliche Verantwortung auszuüben, ist aus mehreren Gründen von Bedeutung.
In einer Welt, die von Kindern sehr früh qualifizierte Entscheidungen verlangt, zum Beispiel bezüglich Alkohol, Drogen oder Sex, ist es wichtig, dass sie eigene Entscheidungen treffen können, auch gegen Gruppenzwang, und dass sie tun, wozu sie sich entscheiden, auch wenn andere das „uncool“ finden. Wenn Eltern ihren Kindern die persönliche Verantwortung für sich selbst nicht zugestehen, etwa beim Essen manipulieren („noch einen Löffel für die Oma...”), vermitteln sie dem Kind: „Vertraue nicht deinem Körper, vertraue mir.“ Das aber macht Kinder fremdbestimmt und anfällig für schlechte Einflüsse.
Die Erwachsenen müssen die Wahrnehmungen, Gefühle und Bedürfnisse der Kinder respektieren und die Äußerungen der kindlichen Gefühle und Bedürfnisse ernst nehmen - genauso ernst wie ihre eigenen. Denn dann achten sie die Unversehrtheit der Person und verhelfen den Kindern zur Selbstachtung, über die 'Abdu'l-Bahá schreibt, dass „.. des Menschen höchste Ehre und wahres Glück in der Selbstachtung liegt, in hohen Entschlüssen und edlen Vorsätzen, in der Unversehrtheit und Sittlichkeit der Person, in der Reinheit des Denkens...“14)
Es ist existentiell wichtig für einen Menschen, seine Integrität, die Unversehrtheit seiner Person, seine Grenzen wirksam schützen zu können. Aufgabe der Eltern ist, die Integrität der Kinder zu achten und ihnen zu zeigen, wie sie ihre Grenzen und ihren Willen (oder ihr Nichtwollen) wirksam zum Ausdruck bringen können. „Die Rechte der Familienmitglieder dürfen nicht verletzt werden, weder die des Sohnes noch die des Vaters oder der Mutter. Niemand darf rücksichtslos sein.“15)
Dass Kinder die persönliche Verantwortung für sich übernehmen und dass sie lernen, ihre Integrität zu schützen, ist zugleich Voraussetzung für die Ausbildung ihrer sozialen Verantwortung. Denn die Verantwortung füreinander in der Familie und der Gesellschaft entwickelt sich natürlicherweise auf der Basis der Eigenverantwortlichkeit - nämlich durch den angeborenen Drang der Kinder zur Zusammenarbeit, ihrer Bereitschaft zur Kooperation. Dies ist eine weitere wichtige Erkenntnis der neueren Säuglings- und Beziehungsforschung13), dass Kinder als soziale Wesen geboren werden.
Kinder werden geboren mit der Bereitschaft, sich an ihre Eltern (oder Bezugspersonen) zu binden, sie nachzuahmen, mit ihnen zu „kooperieren“. Kinder wollen mit ihren Eltern kooperieren, das heißt sie sind von Natur aus darauf angelegt zu gehorchen. Das bedeutet: Eltern müssen von ihren Kindern keinen Gehorsam fordern - denn das bringt „immer Ungehorsam mit sich, offen oder verdeckt. Warum ist das so? Weil es unwürdig und kränkend ist, wenn man auf Kommando gehorchen soll, wo man doch nur zu gern kooperieren will.“16)
Wenn in den Bahá’í-Schriften vom „Gehorsam“ der Kinder den Eltern gegenüber die Rede ist, so ist das in erster Linie als Forderung an die Eltern zu verstehen, sich so zu verhalten, dass die Kinder mit ihnen kooperieren - und das heißt ihnen gehorchen können, ohne ihre eigene Integrität zu verletzen. Das Vorbild, die Lebensführung und das Verhalten der Eltern den Kindern gegenüber bewirken, dass „bei den Kindern spontan der Gehorsam gegenüber den Eltern entsteht“, wie es in der Ridvan-Botschaft 2000 des Universalen Hauses der Gerechtigkeit heißt: „[Eltern] sollten unter keinen Umständen ihre Fähigkeit, den moralischen Charakter ihrer Kinder zu bilden, unterschätzen. Denn sie üben einen unersetzbaren Einfluss durch die häusliche Umgebung aus, die sie bewusst durch ihre Liebe zu Gott, ihr Bemühen, sich an Seine Gesetze zu halten, ihren Geist des Dienstes für Seine Sache, ihre nicht fanatische Einstellung und ihre Freiheit von den zersetzenden Wirkungen der üblen Nachrede schaffen. Jeder Elternteil, der an die Gesegnete Schönheit [Bahá’u’lláh] glaubt, hat die Verantwortung, sich in solcher Weise zu verhalten, wodurch bei den Kindern spontan der Gehorsam gegenüber den Eltern entsteht, dem die Lehren solch hohen Wert beimessen.“
Wenn Kinder erleben, dass ihre Integrität geachtet wird und sie ihre persönliche Verantwortung
[Seite 29] ausüben können, und wenn sie erleben, dass die Erwachsenen in ihrer Umgebung die Verantwortung
für sich selbst übernehmen und sich zugleich im „Dienst am Nächsten“, im Dienst für die
Familie üben, so werden sich die Kinder durch das Beispiel der Erwachsenen selber zu
rücksichtsvollen, einfühlsamen und hilfsbereiten Erwachsenen entwickeln mit dem Wunsch,
anderen zu dienen. Kinder müssen zu sozialer Verantwortlichkeit, zum Dienst für andere
nicht erzogen werden. Sie brauchen keine regelmäßigen häuslichen Pflichten für die
Entwicklung ihrer sozialen Verantwortung. Denn Kinder wollen kooperieren, und sie wollen
beitragen, wollen für andere wertvoll sein, wollen sich als wertvolles Glied der Gemeinschaft
fühlen. Was sie brauchen, sind Eltern, die sie beitragen lassen, die Geduld genug haben, sich
auf die Zeit der Kinder einzustellen, die den Beitrag der Kinder wertschätzen (auch wenn sie
selber das gleiche schneller oder perfekter machen könnten), die es den Kindern ermöglichen,
ihren eigenen, selbst-initiierten Beitrag zu leisten, und die den Kindern dadurch das Gefühl
vermitteln, für die Familie wertvoll zu sein. Es ist also nicht aus pädagogischen Gründen
notwendig, Kindern Pflichten im Haushalt aufzuerlegen. Allerdings kann es für die Eltern
oder für die Familie zur Bewältigung der Hausarbeit nötig werden, den Kindern bestimmte
regelmäßige Aufgaben zu übertragen. Diese sind nach den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen
Familie festzulegen, am besten in Beratung mit den Kindern (zum Beispiel im Familienrat), so
dass die Kinder ein Mitspracherecht haben, welche Aufgaben sie übernehmen. Denn nur wer „nein“
sagen darf, kann auch von ganzem Herzen „ja“ sagen.
ausüben können, und wenn sie erleben, dass die Erwachsenen in ihrer Umgebung die Verantwortung
für sich selbst übernehmen und sich zugleich im „Dienst am Nächsten“, im Dienst für die
Familie üben, so werden sich die Kinder durch das Beispiel der Erwachsenen selber zu
rücksichtsvollen, einfühlsamen und hilfsbereiten Erwachsenen entwickeln mit dem Wunsch,
anderen zu dienen. Kinder müssen zu sozialer Verantwortlichkeit, zum Dienst für andere
nicht erzogen werden. Sie brauchen keine regelmäßigen häuslichen Pflichten für die
Entwicklung ihrer sozialen Verantwortung. Denn Kinder wollen kooperieren, und sie wollen
beitragen, wollen für andere wertvoll sein, wollen sich als wertvolles Glied der Gemeinschaft
fühlen. Was sie brauchen, sind Eltern, die sie beitragen lassen, die Geduld genug haben, sich
auf die Zeit der Kinder einzustellen, die den Beitrag der Kinder wertschätzen (auch wenn sie
selber das gleiche schneller oder perfekter machen könnten), die es den Kindern ermöglichen,
ihren eigenen, selbst-initiierten Beitrag zu leisten, und die den Kindern dadurch das Gefühl
vermitteln, für die Familie wertvoll zu sein. Es ist also nicht aus pädagogischen Gründen
notwendig, Kindern Pflichten im Haushalt aufzuerlegen. Allerdings kann es für die Eltern
oder für die Familie zur Bewältigung der Hausarbeit nötig werden, den Kindern bestimmte
regelmäßige Aufgaben zu übertragen. Diese sind nach den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen
Familie festzulegen, am besten in Beratung mit den Kindern (zum Beispiel im Familienrat), so
dass die Kinder ein Mitspracherecht haben, welche Aufgaben sie übernehmen. Denn nur wer „nein“
sagen darf, kann auch von ganzem Herzen „ja“ sagen.
Jede Familie hat die Aufgabe, für ihre Einheit zu sorgen, indem sie die Bedürfnisse, die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder immer wieder neu ausbalanciert und ins Gleichgewicht bringt. „Die Familie als eine menschliche Einheit nach den Regeln der Heiligkeit”) zu erziehen - darin liegt ein großes Entwicklungspotenzial für die ganze Familie.
QUELLENANGABEN
- 1) 'ABDU'L-BAHÁ, IN: EINHEIT DER FAMILIE, S. 22
- 2) VERBORGENE WORTE, ARAB. 2
- 3) BAHÁ’U’LLÁH, ÄHRENLESE 132:1
- 4) BAHÁ’U’LLÁH, VERBORGENE WORTE PERS.29
- 5) BAHÁ’U’LLÁH, BOTSCHAFTEN aus 'AKKÁ 11:3 = ÄHRENLESE 122
- 6) 'ABDU'L-BAHÁ, IN: EINHEIT DER FamiLie, S.15
- 7) 'ABDU'L-BAHÁ, IN: EINHEIT DER Familie, S.21
- 8) 'ABDU'L-BAHÁ, IN: GEBETE 160
- 9) DER BÁB, EINE AUSWAHL AUS SEINEN SCHRIFTEN 3:22
- 10) BAHÁ’U’LLÁH, IN: EINHEIT DER FAMILIE, S.9
- 11) ZITIERT IN: O. KELLER, DENN MEIN LEBEN IST LERNEN, FREIAMT: MIT KINDERN WACHSEN, 1999, S.254
- 12) SHOGHI EFFENDI, ZUM WIRKLICHEN LEBEN, S. 6
- 13) REMO LARGO, KINDERJAHRE, DIE INDIVIDUALITÄT DES KINDES ALS PÄDAGOGISCHE HERAUSFORDERUNG, MÜNCHEN: PIPER, 2000; JESPER JUUL, DAS KOMPETENTE KIND, REINBEK: ROWOHLT, 1999; JESPER JUUL/ HELLE JENSEN, VOM GEHORSAM ZUR VERANTWORTUNG, FÜR EINE NEUE ERZIEHUNGSKULTUR, DÜSSELDORF UND ZÜRICH: PATMOS, 2004
- 14) 'ABDU'L-BAHÁ, DAS GEHEIMNIS GÖTTLICHER KULTUR, S. 27
- 15) 'ABDU'L-BAHÁ, IN: EINHEIT DER FAMILIE, S.22
- 16) J.JUUL, Das KOMPETENTE KIND, S.83
Karen Reitz-Koncebovski
- promovierte Slavistin und Gymnasiallehrerin
- für Russisch und Mathematik
- zur Zeit freiberuflich tätig,
- insbesondere in der Begabtenförderung
- beschäftigt sich des weiteren mit allgemeiner
- Pädagogik und deren Bezügen zu den Bahá’í-Lehren
- Mutter zweier Kinder
Traditionelle Weisheiten, progressive Prinzipien und praktische Instrumente[Bearbeiten]
Ansätze zu einem positiven Familienkonzept für das 21.Jahrhundert
- „Denkst Du an ein Jahr, so säe einen Samen.
- Denkst Du an ein Jahrzehnt, so pflanze einen Baum.
- Denkst Du an ein Jahrhundert, so erziehe einen Menschen.“
- Orientalische Weisheit
Unsere multikulturelle, globale Gesellschaft steckt mitten in einer tiefen Krise. Diese
Krise ist vielschichtig und multidimensional, und ihre Facetten berühren jeden Aspekt unseres
Lebens: Gesundheit und Lebensführung, die Qualität unserer Umwelt und unsere gesellschaftlichen
Beziehungen, Wirtschaft, Technologie und Politik. Es ist eine Krise von emotionalen,
intellektuellen, moralischen und spirituellen Dimensionen, von einem Umfang und einer
Eindringlichkeit, wie sie in der aufgezeichneten menschlichen Geschichte ohne Beispiel
dasteht. Diese Krise hat einen besonderen Einfluss auf den einzelnen und auf die Familie.
Die Institution der Familie befindet sich in einer Übergangsphase, sie wandelt sich. In vielen Kulturen brechen Familien aufgrund wirtschaftlicher und politischer Probleme auseinander und werden immer schwächer aufgrund des moralischen und geistigen Vakuums. Die Krise betrifft uns tief - an der Basis unserer Beziehungen. „Das große Problem der privaten Existenz ist für die Menschen unserer Epoche die Partnerschaft“, sagt die Psychologieprofessorin Eva Jäggi. Diese Zerbröselung großer Gruppen in lauter Einzelwesen, die zeitweilig einander begegnen, begleitet den kulturellen Umbruch, der die hochentwickelten Gesellschaften allenthalben aus dem Tritt bringt. Da die Familie den Grundstein der menschlichen Gesellschaft bildet, ist ohne eine Neuschöpfung und Wiederbelebung dieser fundamentalen Institution die Zivilisation gefährdet.
Die Symptome sind nicht zu übersehen. Zwar wird als Barometer meist die hohe Zahl von Scheidungen genannt, aber anhand der aufgeführten Daten kann man erkennen, dass es um jeden Aspekt des menschlichen Zusammenlebens derzeit schlecht steht. Folgende Trends zeigen den Zerfall der Familie und der Beziehungsstrukturen:
- Zunahme der Scheidungsrate: In Deutschland liegt sie derzeit bei 35 bis 40 Prozent, in den USA bei 50, in Russland bei 62. Dazu kommen die chronischen Ehekonflikte und Trennungen ohne offizielle Scheidung.
- Abnahme der Kinderzahl und Geburtenhäufigkeit: Seit Jahren sterben in Deutschland mehr Leute als Kinder geboren werden. Die durchschnittliche Kinderzahl liegt derzeit bei 1,3, bei zunehmend als Last empfundener Kindererziehung.
- Abnahme der Eheschließungen: Immer mehr Menschen entscheiden sich zum Zusammenleben „ohne Trauschein“.
- Zunehmende Entfremdung zwischen den Generationen mit Tendenz zur Kleinfamilie und Einsamkeit: Im Jahre 1900 lebten in fast der Hälfte der Privathaushalte fünf oder mehr Personen, 1992 lag der entsprechende Wert nur noch bei 5 Prozent.
- Selbstmordversuche und Tötungsdelikte: Hinter 80 Prozent aller Selbstmordversuche stehen Partnerkonflikte, ebenso bei der Hälfte der Tötungsdelikte
- Zunahme psychosomatischer und psychischer Beschwerden und Erkrankungen: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leidet jeder
- dritte Patient in der Praxis eines Allgemeinarztes an einer psychischen Erkrankung, die einer psychotherapeutischen Behandlung bedarf.
- Zunahme des körperlichen, emotionalen und seelischen Missbrauchs, zunehmende Gewalt innerhalb der Familie, Zunahme außerehelicher Beziehungen, mangelnde Kommunikation, die Unterdrückung von Mädchen und Frauen, Unsicherheit in den Geschlechtsrollen
Diese Krise, dieses emotionale Dauererdbeben betrifft jeden von uns, denn wir leben in einer Familie oder stammen aus einer. Der Jahrhunderte alte Gedanke, dass die Familie für das Wohlergehen des einzelnen und der Gesellschaft unabdinglich und notwendig ist, wird immer mehr in Frage gestellt. Interessanterweise entwickelt sich diese Krise nicht nur im Westen, sondern in allen Kulturen schnell fort, sie ist mittlerweile ein weltweites Problem. Aber im Gegensatz zu Dürre, Hunger oder Umweltproblemen lässt sie sich nicht durch Verträge beseitigen, sondern nur durch einen kollektiven Willensakt und eine völlige Wandlung unserer Einstellung.
Als Ursachen der heutigen Ehekrise und des Eheverdrusses werden viele Gründe diskutiert, von denen einige näher betrachtet werden sollen. Dennoch sind die Gründe für Scheidungen weitgehend ungeklärt, zumindest in der vorhandenen Literatur. Bei deren Durchsicht fällt auf, dass sich die meisten Forscher auf eine Analyse der heutigen Krise beschränken, aber kaum etwas zu deren Erklärung, geschweige denn zu konstruktiven Lösungsansätzen beitragen. Aber vielleicht spricht gerade diese Sprachlosigkeit für sich: Sie spiegelt die Tiefe der Krise wider. Denn die psychischen und gesellschaftlichen Vorgänge, die schließlich zur Scheidung führen, sind zu komplex, als dass sie durch eine einzige Ursache zu erklären wären.
Die folgende Analyse soll auch gleichzeitig Ansätze für die Zukunft bieten. 1)
- FEHLENDE ODER MANGELNDE EHEVORBEREITUNG: Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Zeit wir für die wichtigste Entscheidung des persönlichen Lebens - die Wahl des Ehepartners - aufwenden, im Vergleich zu jahrelangem Studium oder anderen beruflichen Entscheidungen. Die fehlende Ausbildung im Bereich Partnerschaft, Zusammenleben und Kindererziehung ist hier als eine der Hauptursachen für das Scheitern vieler Beziehungen aufzuführen.
- MANGELNDE VORBILDER: Es mangelt uns nicht nur an dem Beispiel guter Ehen im eigenen Familien- und Freundeskreis, auch in der Gesellschaft ist die Familie nicht mehr „in“.
- ZUNEHMENDE INDIVIDUALISIERUNG: Transkulturelle Untersuchungen haben gezeigt, dass individualistische Kulturen, im Gegensatz zu kollektivistischen, der Liebe mehr Bedeutung in der Ehe und bei Beziehungsentscheidungen beimessen. Wo die Liebe eine größere Bedeutung hat, finden wir neben wirtschaftlichem Wohlstand eine steigende Eheschließungsrate, höhere Scheidungsquoten und niedrigere Geburtsziffern. Aus psychotherapeutischer Sicht nehmen die Ich-Störungen, also die schweren Identitätsstörungen, in der ich-zentrierten Gesellschaft drastisch zu. Auch das Streben nach völliger (äußerer) Freiheit, häufig unter Aufgabe der inneren Freiheit, hat zur Krise beigetragen.
- ÜBERBETONUNG DER SEXUALITÄT: Es gibt Untersuchungen, wonach Paare, die bereits vor der Ehe zusammengelebt hatten, ein um 40 Prozent höheres Scheidungsrisiko haben als andere, die das nicht getan hatten. Dass sexuelle Erfahrung vor der Ehe oder körperliche Kompatibilität für
- eine glückliche Ehe ausreichend sind, hat sich nicht bestätigt. Auch das ist ein Ergebnis der sexuellen Freiheit.
- ZUNAHME DER SINNKRISE: Für immer mehr Menschen scheint eine befriedigende Paarbeziehung die wichtigste Quelle von Sinn zu sein. Von der Liebe des Partners erwartet man nicht nur Intensität, Verschmelzung, Lust und Freude, man erwartet von Ihr nicht nur „Lebensqualität“ man erwartet von ihr das Heil schlechthin. Autoren wie Hans Jellouschek sprechen von der Partnerliebe als einer Art Religionsersatz, als einer religiösen Sehnsucht, die sich nicht mehr auf ein Jenseits, sondern auf diese Welt, auf den Partner richtet. Dass die Übertragung der religiösen Sehnsucht auf die Partnerliebe wahrscheinlich eine der entscheidenden Wurzeln heutiger Beziehungsinstabilität ist, wurde bisher wenig beachtet.
Experten und Betroffene halten Ausschau nach neuen Lösungen oder versuchen, solche zu
entwickeln. Der kanadische Psychiater Hossein Danesh reduziert seinen Ansatz auf drei
Fragen: Soll die Familie abgeschafft werden? Können wir ohne die Familie leben? Gibt
es eine Alternative dazu?
Zwei Hauptrichtungen haben sich herausgebildet: Die einen erklären die Institution der Familie als überholt und veraltet, sprechen gar vom Tod der Institution Ehe, fordern die Abschaffung der Familie und suchen nach außerfamiliären Lebensformen. Insbesondere die hohen Scheidungsquoten haben nicht nur bei Fachleuten zu der Frage geführt, ob die Familie, so wie sie heute existiert, nicht am besten abgeschafft werden sollte. Andere propagieren neue Formen des menschlichen Zusammenlebens wie das Konzept des „Lebensabschnittspartners", die homosexuelle Ehe, die offene Ehe als Weg zur Überwindung des traditionellen Familienkonzepts, um nur einige dieser Experimente zu nennen. Auch Gesellschaftsformen haben systematisch die Familie zur Durchsetzung Ihrer eigenen Ideologie ausgenutzt und schließlich zerstört — sowohl im Westen als auch im Osten. Bemerkenswert, dass die beiden Supermächte auch bei den Scheidungsquoten führend sind. Aber auch Eheverträge, verschiedenste Arten von Scheidungsversicherungen und gar ein Ehe-TÜV (H.W. Jürgens und sein Verein Demos e.V.) können den Prozess der Familienkrise nicht aufhalten.
Wenn wir die Familien und ihre Beziehungsstrukturen betrachten, so erkennen wir, dass die Institution der Familie häufig ein Mittel der Kontrolle, des Missbrauchs und der Gewalt gegenüber schwächeren Mitgliedern, vor allem Frauen und Mädchen, gewesen ist und noch ist. Der Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten für die Frau und die fehlende Gleichwertigkeit der Geschlechter ist eine der Hauptursachen für die heutige Krise und die Ablehnung der Institution Familie. Wir können deshalb die Frage, ob die Familie, so wie sie heute existiert, abgeschafft werden sollte, bejahen. Die nur auf Autorität und Macht basierende Ehe hat keinen Platz mehr in der anstehenden neuen Ära reifer und gleichwertiger Partnerschaften, deren Merkmal das Prinzip der Einheit ist.
Bei der Frage nach Abschaffung oder Ersatz für die Familie soll hier nur auf zwei Aspekte eingegangen werden: auf die Kindererziehung und die Partnerbeziehung. Die Familie war schon immer das Milieu, in dem Kinder reifen und wachsen können. Nur die Familie, gegründet auf Liebe, Einheit und Gleichwertigkeit, kann dem Kind bei der Entwicklung von Körper, Intellekt, Emotionen und Geist helfen. Die Männer- und Frauenbilder, die uns durch unsere Eltern vermittelt werden und notwendig für unser eigenes Selbstbild und spätere Beziehungen sind, das Gefühl und die Entwicklung des Ur-Vertrauens (Erikson), all das kann nur in der Familie vermittelt werden.
Ebenso kann nur die Stabilität und der Rahmen einer Ehe dem Menschen dasjenige
Gefühl von
[Seite 33] Sicherheit, Treue, Vertrauen und Geborgenheit bieten, das er braucht, um sich seinem
Partner voll hingeben zu können - in körperlicher und emotionaler Hinsicht. Das
allein zeigt schon, dass unser Ziel die Beziehung zu einem Lebenspartner sein
muss und nicht zu mehreren. Und daher ist das Konzept des Lebensabschnittspartners, so
interessant, verlockend und rational verständlich es auch klingen mag, emotional nicht
durchzuhalten.
Sicherheit, Treue, Vertrauen und Geborgenheit bieten, das er braucht, um sich seinem
Partner voll hingeben zu können - in körperlicher und emotionaler Hinsicht. Das
allein zeigt schon, dass unser Ziel die Beziehung zu einem Lebenspartner sein
muss und nicht zu mehreren. Und daher ist das Konzept des Lebensabschnittspartners, so
interessant, verlockend und rational verständlich es auch klingen mag, emotional nicht
durchzuhalten.
Die „Experimente“ der vergangenen Jahrzehnte haben eines mit Sicherheit gezeigt: Keine noch so gut organisierte Einrichtung oder Institution, weder staatlicher, religiöser oder professioneller Art, kann die Familie ersetzen - vor allem nicht bei der Kindererziehung. Keine kann jemals die so wichtige primäre Einheit von Eltern und Kindern ersetzen, die erst ein gesundes emotionales Heranwachsen ermöglicht. Diese Einrichtungen sind für die weitere Entwicklung sehr wichtig, aber kein Ersatz für die Familie. Erziehung kann nicht von den Eltern auf andere delegiert werden, so sehr es manchmal gewünscht wird. Familienexperten wie Professor Danesh gehen davon aus, dass die Wut, Ablehnung und Aggression vieler Kinder gegen ihre Eltern ihre Ursachen in Gefühlen des Abgelehntseins und Verlassenwerdens in der Kindheit hat. Diese Reaktionen finden sich häufig bei Kindern, die früh von den Eltern emotional getrennt wurden.
Die Vertreter der zweiten Richtung suchen nach neuen Wertmaßstäben und Prinzipien für die Familie. Ihnen geht es nicht um eine Alternative zur Familie, sondern um ein alternatives Familienmodell, ein neues Familienkonzept. Um diesen Weg zu gehen, bedarf es einer grundsätzlichen Neuorientierung und eines neuen Verständnisses vom Wesen des Menschen. Denn bevor wir uns mit den Prinzipien eines neuen Familienkonzeptes beschäftigen, müssen wir uns mit dem Menschenbild auseinandersetzen, das der neuen Familie zugrunde liegen soll. Diese Frage ist die Grundfrage von Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie geworden. Hier geht es nicht nur um Natur, Eigenart, Wesen und Ziel des Menschen, sondern auch um Aussagen zu Verantwortlichkeit, Freiheit, Entscheidungsfähigkeit und Wille. Und es geht um die Annahme der Veränderbarkeit des Menschen, um seine Sinnorientiertheit, um die „Idee vom Menschen als einem aktiven Gestalter seiner eigenen Existenz“.2)
Man kann heute feststellen, dass die Gesellschaft und der einzelne am fehlenden oder negativen Menschenbild kranken. All die Theorien von der angeborenen Aggressivität des Menschen, des Bösen in ihm und gar der Erbsünde - von der Christus nichts gesagt hat - haben ausgedient, falls sie jemals gedient haben. Was wir brauchen, ist ein neues, positives Menschenbild.
Wir glauben daran, dass der Mensch seinem Wesen nach gut ist. Der Bahá’í-Glaube geht noch einen Schritt weiter und lehrt, dass der Mensch nicht nur seinem Wesen nach gut ist, sondern „als ein Bergwerk voller Edelsteine“(..) betrachtet werden sollte. Dieses Menschenbild ist eine Revolution. Es eröffnet nicht nur völlig neue Perspektiven, sondern befreit den Menschen und die Menschheit vom Joch des Bösen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine neue Religion ein derartiges revolutionäres Menschenbild formuliert, denn ist nicht jede religiöse Offenbarung eine Revolution? War es nicht schon seit jeher die Aufgabe der großen Propheten wie Buddha, Moses, Christus oder Muhammad, Menschenbilder zu lehren und prägen? Immer bedurfte es mutiger Männer und Frauen, diese anzunehmen und in ihrem Leben umzusetzen. Vielleicht ist es wieder an der Zeit, auf diese großen geistigen Lehrer zu hören. Das neue Menschenbild hat seit seiner Darlegung vor fast 160 Jahren verschiedenste Bereiche des menschlichen Lebens nachhaltig beeinflusst: Erziehung, Pädagogik, Psychotherapie und Medizin, um nur einige zu nennen.
[Seite 34] Das neue Familienkonzept basiert im wesentlichen auf drei Säulen: auf traditionellen
Weisheiten, progressiven Prinzipien und praktischen Instrumenten. Einige Prinzipien scheinen
einleuchtend, fast schon banal. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass derzeit kein einziges
universell akzeptiert wird.
Das neue Familienkonzept basiert im wesentlichen auf drei Säulen: auf traditionellen
Weisheiten, progressiven Prinzipien und praktischen Instrumenten. Einige Prinzipien scheinen
einleuchtend, fast schon banal. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass derzeit kein einziges
universell akzeptiert wird.
Dass die Familie die Grundlage der Gesellschaft ist, wird zwar allgemein akzeptiert, aber gehandelt wird selten danach. Die Gesellschaft muss wieder mehr familienorientiert und familienfreundlich werden, eine bloße Erhöhung des Kindergeldes ist sicherlich nicht ausreichend. Weiterhin gehen wir davon aus, dass die Ehe zwischen einem Mann und der mit ihm verheirateten Frau die Basis der Familie bildet. Hierher gehört auch die Anerkennung der Ehe als ein ewiges „Band“, als eine auch nach dem Tod andauernde Vereinigung beider Partner. Ehe ist somit eine göttliche Institution. Sie basiert auf Liebe und Treue zwischen den beiden Partnern und hat als wesentlichen sozialen Aspekt das Hervorbringen und die Erziehung von Kindern. Hier gibt es sehr interessante kulturelle Unterschiede: hier die westlich-individualistische Ehe, deren Wesen von der Zweierbeziehung geprägt wird, und dort die orientalisch-kollektivistische Ehe, die die Kinder in den Mittelpunkt stellt.
Die Mutter gilt als die erste Erzieherin des Kindes, aber nicht als die alleinige. Der Vater ist primär für die finanzielle Versorgung der Familie verantwortlich, aber wiederum nicht ausschließlich. Um dies zu fördern, ist die gesellschaftliche Anerkennung der Hausarbeit und Kindererziehung unbedingt erforderlich, um das „Nur-Hausfrau-und-Mutter-Syndrom“ zu überwinden.
Progressive Prinzipien des neuen Familienkonzeptes sind die Monogamie, die Ermutigung zur Heirat, aber nicht die Pflicht zur Ehe, das freiwillige Einverständnis beider Partner zur Heirat, die Möglichkeit der Scheidung, aber nur nach einem sogenannten Jahr der Geduld, die Ehevorbereitung in der Familie und in den Schulen, die Zustimmung der Eltern zur Heirat, der geistig-religiöse Aspekt der Beziehung und die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Partner. Die Zustimmung der Eltern zur Heirat ist für das westliches Verständnis zunächst häufig schwer verständlich, aber Erfahrungen in orientalischen Kulturen und vor allem partnertherapeutische Erfahrungen zeigen, wie wichtig die Ansicht der Eltern bei der Partnerwahl und später die Unterstützung während des Familienlebens sind. Es gibt nur wenige Ehepaare, die über lange Jahre hinweg den Druck negativ eingestellter Eltern aushalten und ihre Ehe beschützen können. Die Zustimmung der Eltern wird hier unter progressiven Prinzipien aufgeführt, da im Gegensatz zum traditionellen Ritus hier die Zustimmung des Paares an erster Stelle steht. Ganz wichtig ist beim neuen Familienmodell, dass die Einheit zwischen den Partnern und in der Familie an erster Stelle steht und Vorrang hat vor allem anderen: Wenn eine Familie gegründet worden ist, dann ist diese zu beschützen und zu fördern das Hauptanliegen, andere Interessen oder Verpflichtungen müssen dem untergeordnet werden. Progressiv bedeutet, dass die Ehepartner sich bemühen sollen, eine Beziehung auf allen vier Ebenen zu führen: auf der körperlichen, intellektuellen, emotional-sozialen und auf der geistig-spirituellen Ebene. Das Kind erhält seine Bildung zwar in der Schule, aber sein Charakter und seine sittliche und geistige Einstellung wachsen zu Hause heran und werden hier geformt. Die Kindererziehung muss alle vier Bereiche des Menschen umfassen, wir benötigen sowohl körperliche, intellektuelle, emotionale als auch geistige Erziehung. Die geistig-religiöse Erziehung des Kindes ist eine besondere Verantwortung der Eltern, die nicht an die Schule oder andere Erziehungseinrichtungen delegiert werden kann. Der Erziehung und Bildung von Mädchen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da sie die Mütter und Erzieherinnen von morgen sind. Der Bahá’í-Glaube geht sogar soweit, dass bei finanziellen Nöten der Eltern der Erziehung und Bildung der Tochter der Vorrang zu geben ist.
[Seite 35] Praktische Instrumente sind die liebevolle und offene Beratung in allen Angelegenheiten, denn das
Instrument zur Lösung sämtlicher Angelegenheiten liegt im Austausch. Dem zugrunde liegt das bereits
erwähnte positive Menschenbild, die Gleichwertigkeit aller Familienmitglieder, was bedeutet, dass
jede Meinung gleich viel wert ist und das Recht hat, gehört und bedacht zu werden, und die Liebe
in der Familie.
Praktische Instrumente sind die liebevolle und offene Beratung in allen Angelegenheiten, denn das
Instrument zur Lösung sämtlicher Angelegenheiten liegt im Austausch. Dem zugrunde liegt das bereits
erwähnte positive Menschenbild, die Gleichwertigkeit aller Familienmitglieder, was bedeutet, dass
jede Meinung gleich viel wert ist und das Recht hat, gehört und bedacht zu werden, und die Liebe
in der Familie.
Ein praktischer Weg zur Lösung von Angelegenheiten und Problemen in der Familie ist die regelmäßige Beratung in einem Familienrat. Dessen Hauptgedanke ist, dass alle in einem Haushalt zusammenlebenden Familienmitglieder sich einmal wöchentlich versammeln, um über ihre Angelegenheiten zu beraten. Obwohl der Rat im Grunde eine alte Einrichtung ist, wird die Beratung heute oft in den Hintergrund gedrängt. Viele Psychologen sprechen deshalb vom Zeitalter des Kommunikationsmangels und sehen diesen als eine der Hauptursachen für das Scheitern vieler Beziehungen an. Durch das Mittel der Familien- oder Ehepartnergruppe wird nicht nur ein regelmäßiges Gesprächsforum eingerichtet, sondern es wird auch nicht mehr dem Zufall überlassen, ob sich ein Gespräch zwischen den Familienmitgliedern ergibt oder nicht. Wir können sicher sein, dass die regelmäßige Teilnahme an einem Familienrat vor allem für Kinder eine der besten Vorbereitungen für das spätere Leben in der Gesellschaft darstellt. Sie lernen in der Beratung nicht nur das Gefühl der sozialen Gleichwertigkeit, sondern sie erfahren unmittelbar, dass sie liebenswerte und wertvolle Wesen sind. Gleichzeitig erleben sie die Interaktion der Eltern, die im Idealfall ein Vorbild für die eigene spätere Partnerbeziehung darstellt.
Eine weitere Notwendigkeit für das positive Familienkonzept ist eine bewusstere Ehevorbereitung und Partnerwahl. Die Vorbereitung auf das spätere Familienleben muss zu Hause beginnen, aber sie wird erst dann universell akzeptiert werden, wenn sie sowohl in Schulen als auch an Universitäten als gleichwertiges Unterrichtsfach neben Naturwissenschaften und Sprachen gelehrt wird.
Am Anfang war die Rede von der Familie im Umbruch. Jetzt kommt es darauf an, vom Umbruch zur Transformation (Danesh) zu gelangen. Mit dem vorgestellten neuen Familienkonzept werden erstmals traditionelle Werte mit zeitgemäßen Bedürfnissen und wissenschaftlicher Erkenntnis verbunden. Die genannten Prinzipien werden schrittweise weltweit in rund 17.000 organisierten lokalen Bahá’í-Gemeinden umgesetzt, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Einheit der Menschheit zu leisten. Denn die Beziehungen und Abhängigkeiten von Familie, Nation und einer zukünftigen Weltzivilisation werden immer deutlicher:
- „Vergleiche die Nationen der Welt mit den Mitgliedern einer Familie.
- Eine Familie ist eine Nation im Kleinen. Erweitere den Kreis des Haushalts, und du erhältst die Nation. Vergrößere den Kreis der Nationen, und du hast die gesamte Menschheit.“
- 'Abdu'l-Bahá
- 1) EINE AUSFÜHRLICHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER FRAGE DER EHEVORBEREITUNG UND PARTNERWAHL IST IN VORBEREITUNG: HAMID PESESCHKIAN: I LOVE HIM, BUT I DON'T LIKE HIM - WEGE ZU EINER BEWUSSTEREN EHEVORBEREITUNG UND PARTNERWAHL
- 2) CH. BÜHLER UND M. ALLEN, EINFÜHRUNG IN DIE HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE. KLETT, STUTTGART, 1973
- WEITERFÜHRENDE LITERATUR BEIM VERFASSER
Dr. med. habil. Hamid Peseschkian
- ist Facharzt für Neurologie,
- Psychiatrie und Psychotherapie,
- Geschäftsführer der
- Wiesbadener Akademie für Psychotherapie,
- Lehrbeauftragter im Psychologischen Institut
- der Universität Mainz und Gastprofessor der
- Medizinischen Hochschule Archangelsk (Russland)
- Der Autor lebt mit seiner Frau
- und zwei Kindern in Mainz
Alkohol und die Folgen[Bearbeiten]
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Etwa 5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind suchtkrank. Die weitaus größte Gruppe stellen die Alkoholiker mit 25 Millionen. Etwa 15 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten, etwa 150000 von illegalen Drogen.
Im Durchschnitt nimmt jeder Bundesbürger jährlich mehr als elf Liter reinen Alkohol zu sich, fast viermal soviel wie um 1950. Alkoholabhängige stellen die größte Patientengruppe in psychiatrischen Bezirks- und Landeskrankenhäusern. Etwa 15 Prozent der Patienten in Allgemeinkrankenhäusern sind alkoholkrank.
Durch Krankenhausbehandlung, Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit und Unfälle verursachen Alkoholabhängige einen jährlichen Schaden von mindestens 20 Milliarden Euro. Dem stehen Einnahmen durch die Alkoholsteuer von 8 Milliarden Euro gegenüber.
Die 40,000 durch Alkohol verursachten Todesfälle im Jahr werden nur noch von den 120,000 Nikotintoten übertroffen.
Dennoch belegen diese Zahlen bestenfalls einen Aspekt des Problems. Statistisch unberücksichtigt bleiben die schleichenden Auswirkungen der Sucht auf die Menschen, die mit dem Alkoholiker zusammenleben. Was der Alkoholkranke seiner Familie, seinen Kindern antut, entzieht sich jeder Messung. Das tatsächliche Ausmaß der hier angerichteten Zerstörung lässt sich erahnen, wenn man Fallbeispiele untersucht.
Nachgewiesen ist, dass Kinder aus alkoholbelasteten Familien dreimal häufiger selbst abhängig werden. Das Vorbild der Eltern hat eine erzieherische Wirkung, die weit stärker ist als schulische Aufklärung, Mit diesem Aspekt wird sich der folgende Text befassen.
In einem anderen Artikel dieser Ausgabe wurde auf die Bedeutung des Vertrauens, auf die für Kinder existenzielle Wichtigkeit verlässlicher Beziehungen zu ihren Eltern eingegangen.
Wer einmal das ungläubige Entsetzen beobachtet hat, mit dem kleine Kinder reagieren, wenn sie zum ersten Mal einen Betrunkenen sehen, der wird diesen Eindruck niemals vergessen.
Wenn es sich dabei um nahestehende und liebgewonnene Personen handelt, bricht für Kinder eine Welt zusammen. Der Erwachsene, der eben noch Vorbild und Orientierung war, ist plötzlich ein willenloses, lallendes Wesen, das seine Körperfunktionen nicht mehr kontrollieren kann, jemand, der nicht mehr ansprechbar ist und durch sein Verhalten Ekel und Abscheu auslöst. Der Schock, das Schamgefühl, das dieses Erlebnis auslöst, wirkt oft ein Leben lang nach.
[Seite 37] Wie kann ein Kind sein Vertrauen in die Welt wiederfinden, wenn die Menschen, die seine
Sicherheit und Stütze waren, sich regelmäßig in unzurechnungsfähige Schwächlinge verwandeln?
Ein Kind, das dies erleben muss, wird an allem zu zweifeln lernen und die Überzeugung entwickeln,
dass auf Menschen kein Verlass ist. Tiefsitzendes Misstrauen in Beziehungen wird wie eine
Krankheit Besitz von seiner Seele ergreifen und seine Fähigkeit zu vertrauensvoller Kooperation
zerstören. Wie werden solche Menschen ihre gesellschaftlichen Beziehungen gestalten? Werden sie
teamfähig oder gar liebesfähig sein?
Wie kann ein Kind sein Vertrauen in die Welt wiederfinden, wenn die Menschen, die seine
Sicherheit und Stütze waren, sich regelmäßig in unzurechnungsfähige Schwächlinge verwandeln?
Ein Kind, das dies erleben muss, wird an allem zu zweifeln lernen und die Überzeugung entwickeln,
dass auf Menschen kein Verlass ist. Tiefsitzendes Misstrauen in Beziehungen wird wie eine
Krankheit Besitz von seiner Seele ergreifen und seine Fähigkeit zu vertrauensvoller Kooperation
zerstören. Wie werden solche Menschen ihre gesellschaftlichen Beziehungen gestalten? Werden sie
teamfähig oder gar liebesfähig sein?
Bisher gingen wir von dem günstigen Fall aus, dass das alkoholabhängige Elternteil nicht gewalttätig ist, was vermutlich in der Mehrheit der Fälle nicht zutrifft. Wenn Vater oder Mutter zusätzlich als ständige Bedrohung, als angsteinflößende Monster in Erscheinung treten, was bleibt einem Kind dann? Wird es nicht die Welt als einen feindlichen Ort wahrnehmen, von dem man sich bestenfalls durch Flucht, Aggression, rücksichtslosen Egoismus und Zynismus distanzieren kann? Können solche Menschen die Gestalter einer menschenwürdigen und lebenswerten Zukunft sein? Wie viele Beziehungen enden aufgrund von Alkoholmißbrauch in Gewaltexzessen vor allem gegen Frauen?
Dennoch ist Alkohol die vermutlich am meisten verharmloste Droge, Eltern wiegen sich in der Überzeugung, ihren Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Ihr beibringen zu können und führen sie nicht selten kumpelhaft ein in die Gemeinschaft der Eingeweihten. Was suggerieren sie ihren Kindern damit? Dass Erwachsenwerden sich in der Fähigkeit zu trinken ausdrückt. Und da man als Kind umgeben ist von Erwachsenen, die oft Alkohol trinken, werden sich die durch solche Vorbilder Ermunterten so früh wie möglich in die Gemeinschaft der Trinker einzugliedern versuchen. Rauchen und Trinken als Attribute der Reife: Die Werbung macht damit Milliardenumsätze; süchtige Schauspieler und Politiker tragen ihre Abhängigkeit öffentlich zur Schau und ermuntern dadurch die nachwachsende Generation, es ihnen gleich zu tun. Wer fröhlich sein will, muss trinken! Für viele Jugendliche erscheint es undenkbar, dass man in Partystimmung kommen kann, ohne sich dabei voll laufen zu lassen. Keine Feierei ohne Reiherei.
Während das Einstiegsalter in die Droge Alkohol immer mehr sinkt, hat die neuere Hirnforschung einige bemerkenswerte Dinge herausgefunden. In der Pubertät und danach, zwischen 12 und 18 Jahren, entwickelt sich als letzter Teil des menschlichen Gehirns der hinter der Stirn sitzende Frontallappen. Dieser ist zuständig für die Kontrolle der Emotionen, die Fähigkeit sich selbst zu beherrschen. Wird in dieser Zeit regelmäßig Alkohol getrunken - und das ist das Partyalter mit seinen wöchentlichen Trinkexzessen — so kann sich dieser Teil des Gehirns nicht entwickeln, und der Betroffene bleibt lebenslang in seiner Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, zur Emotionskontrolle eingeschränkt. Das aber sind die Fähigkeiten, die den Erwachsenen zu dem machen, was er sein soll; ein Wesen, das die Folgen seiner Handlungen überschauen, das vermeidbaren Schaden von sich und anderen abwenden und Verantwortung übernehmen kann. Darüber hinaus zerstört regelmäßiger Alkoholkonsum Gehirnzellen, der entstandene Hirnschwund lässt sich mit der Computertomografie nachweisen. Aber es gibt einen noch direkteren Weg in die geistige Behinderung: Trinkt die werdende Mutter in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, so sind je nach zugeführter Menge körperliche Missbildungen die Folge, während in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten vor allem die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt wird.
Dass sich Politiker der Auswirkungen des Alkohols auf Jugendliche zum Teil bewusst zu sein scheinen, zeigt das jüngst den sogenannten Alkopops gewidmete Gesetz, mit dem versucht werden soll, zumindest ihrem unbeabsichtigten Alkoholmissbrauch gewisse Grenzen zu setzen. Was aber nach wie vor aussteht, ist eine klare Stellungnahme und gezielte Aufklärung, die mit der Wirkung der allgegenwärtigen Alkoholwerbung Schritt halten könnte. In erster Linie aber sind die Eltern gefragt, von deren Vorbild es abhängt, ob Alkohol als gesellschaftliche Norm akzeptiert und verharmlost wird oder seine wahren Folgen begriffen werden.
- Roland Greis
Familie im Wandel: Aufbruch in eine neue Dimension der Beziehungsqualität[Bearbeiten]
- Die problematische Situation, in der sich familiäre Systeme zunehmend befinden, erscheint auf den ersten Blick bedrohlich. Eine Veränderung des Blickwinkels ermöglicht jedoch nicht nur einen erweiterten Zugang zum Thema, sondern auch ein wachsendes Verständnis für jene Faktoren, die eine maßgebliche Rolle in der derzeitigen Phase der Veränderung spielen werden, um die mit der Krise des Systems Familie verbundenen Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu meistern!
„Die Familien sind zerfallen .. Wir besuchen einander immer seltener und wir teilen
nicht mehr, was wir haben. Materiell sind wir reicher als früher, aber spirituell sind
wir verarmt.”1)
Richten wir unseren Blick auf die Auflösungserscheinungen, die die Institution Familie erfasst haben, erschreckt uns das, macht uns nachdenklich und wirft Fragen auf, deren Beantwortung nicht leicht fällt. Daher sollten wir sinnbildlich einmal einen Schritt zurück treten und für einen Moment eine positive Haltung gegenüber diesem Phänomen einnehmen. Vor unserem inneren Auge eröffnet sich dann ein neues Panorama.
Das Modell Familie erfährt Veränderung. Veränderung ist ein Zeichen von Entwicklung. Im Gegensatz dazu bedeutet Stillstand, dass Entwicklung und Fortschritt nicht sinnvoll oder möglich sind. Das wäre in unserem konkreten Beispiel dann der Fall, wenn das Modell Familie nicht verbesserungswürdig wäre - weil es ohnehin ein Auslaufmodell ist - oder nicht verbesserungsfähig - weil die optimale Ausprägung bereits erreicht ist.
Beides scheint jedoch nicht zuzutreffen: Die jüngste spirituell-geistige Erneuerung der Religion durch Bahá’u’lláh, den Stifter des Bahá’í-Glaubens, bestätigt die Bedeutsamkeit der Institution Familie. Somit kann sie kein überholtes Modell sein. Und in sämtlichen industrialisierten Gesellschaften der Welt zeigt sich in unterschiedlichem Ausmaß eine krisenhafte Situation in den Familien. Somit kann von einer bereits optimalen Form ebenfalls nicht die Rede sein.
Folgen wir weiter der Überlegung, dass Krisen Schauplätze bevorstehender Entwicklungen sind, befinden wir uns also in einer Phase, in der ein Qualitätssprung im System Familie möglich ist - ein aufregender Gedanke!
DIE SCHLANGE HÄUTET SICH: ÜBER INHALT UND FORM
Die Auswertung von Daten einer repräsentativen nationalen Befragung an 799 Familien in den Vereinigten Staaten von Amerika ergab, dass die Familienform nicht ausschlaggebend für das gute Gedeihen von Kindern ist. Gehen wir davon aus, dass das Modell Familie nicht obsolet geworden ist, erschließt sich uns vor dem Hintergrund dieser Studie ein wichtiger Aspekt: der Inhalt im Wechselspiel mit der Form. Form und Inhalt ergänzen einander. Die äußere Form der familiären Struktur bildet und hat immer den Rahmen gebildet, innerhalb dessen die Anlagen und Potenziale des sozialen Wesens Mensch zur Entfaltung gebracht werden können. Sie ist der ultimative Ort des Lernens, Erfahrens, Erkennens und Bewusstwerdens elementarer Aspekte menschlichen Seins und Miteinander-Seins.
Doch wenn nun die Form, aus welchen Gründen auch immer, zerbricht, bleibt trotzdem der Inhalt,
die Entwicklungsaufgabe, bestehen. Wenn die Studie nahe legt, dass dieser Inhalt auch in
anderen Formen erschlossen werden kann, wenn die ursprüngliche Form der „Institution Familie“
nicht (mehr) verfügbar ist, gibt sie uns gleichzeitig Aufschluss darüber, worin dieser Inhalt
besteht. Wir können in Folge dieses Wissen nutzen, um die
[Seite 39] Qualität unseres eigenen familiären Gefüges zu analysieren und die Potenziale zu definieren,
die darauf warten, erschlossen und weiter ausgebaut zu werden.
Qualität unseres eigenen familiären Gefüges zu analysieren und die Potenziale zu definieren,
die darauf warten, erschlossen und weiter ausgebaut zu werden.
Was können wir aus dem Auseinanderbrechen von Form und Inhalt schließen? Was zeichnet den Qualitätssprung im System Familie aus?
TRADITION UND MODERNE: UNSER ROLLENVERSTÄNDNIS
Immer dann, wenn Traditionen ins Wanken geraten, wenn Gesellschaften und damit Einzelne sich in einer Übergangszeit befinden, wird der drohende Zerfall von Institutionen und/oder Werten thematisiert. Die Tradition der Institution Familie zeichnet sich über viele Jahrhunderte aus durch ihre Definition als primäre Zweck- oder Wirtschaftsgemeinschaft, die nach einer durchschnittlichen Dauer von 20 Jahren aufgrund des Todes eines Partners endete und gekennzeichnet war von einer klaren und kaum hinterfragbaren Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Soweit die traditionelle Form. Heute fällt die wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung einer lebenslangen Ehe in vielen Fällen weg. Es entfällt das Diktum, die Familie um jeden Preis zu erhalten. Der soziale Wandel eröffnete den Raum für die Neubestimmung der Geschlechterbeziehungen und damit einhergehend die Neukonstruktion von Lebensverläufen. Sie erfordern nun von beiden Partnern im Umgang miteinander Fähigkeiten, welche die traditionelle Form der Ehe und Familie den Menschen nicht abverlangte.
NEUE FREIHEIT: VON DER NOTWENDIGKEIT ZUR BEWUSSTEN WAHL
Das Auseinanderbrechen von familiären Systemen hat dazu geführt, dass Form und Inhalt unabhängig voneinander betrachtet werden können. Wir erkennen damit zunehmend deutlicher, welche Inhalte im Entwicklungsfeld Familie von Bedeutung sind. Wir erleben hautnah, welche Fähigkeiten und welches Bewusstsein förderlich sind - und welche unsere Bemühungen um ein positives familiäres Zusammenleben zum Scheitern bringen.
Die Menschheit scheint damit in ein Stadium ihrer Entwicklung zu treten, in dem es möglich wird, auf breiter Basis wirtschaftlichen und/oder sozialen Zwang durch Entscheidung, Notwendigkeit durch bewusstes Wählen zu ersetzen. Wenn keine zwingende Notwendigkeit zum Erhalt eines Familiensystems mehr besteht, kann über den Weg der bewussten Reflektion und der freien Entscheidung eine Transformation im Bewusstsein der Menschen einsetzen. Potenziale, die das Zusammenleben in einem familiären System birgt, können erschlossen werden.
NEUE ERFORDERNISSE: FÄHIGKEITEN
Sich in ein traditionell vorgezeichnetes Leben einzufügen, erschließt in Menschen andere Fähigkeiten, als wenn sie aktiv und kreativ an einer neuen Beziehungsqualität im Rahmen der Familie mitgestalten, die wiederum das System Familie auf eine neue Qualitätsstufe hebt. Welche Fähigkeiten werden nun benötigt, um dieser Herausforderung zu begegnen? Welches Bewusstsein sind wir aufgerufen zu entwickeln?
Die Beziehung der Eltern zueinander wirkt sich direkt aus auf die Qualität der Beziehungen im gesamten familiären System und die Entwicklung der einzelnen Familienmitglieder. Dabei sind die Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten der Partner von zentraler Bedeutung.
Während der frühen Entwicklung ist es darüber hinaus vor allem das emotionale Klima in der Familie, das zunächst für den Entwicklungsweg eines Kindes maßgebliche Weichen stellt. Die Art und Weise, wie die Mitglieder einer Familie miteinander umgehen, wie sie sich über das Alltagsgeschehen, aber auch über innere Gemütszustände oder eigene Wünsche und Hoffnungen austauschen, bilden den Rahmen, in dem auch die Beziehungen mit dem Kind gestaltet werden.3) Anders als für die Entwicklung der Intelligenz, der Sprache oder der motorischen Fähigkeiten, bei denen früh auftretende Schädigungen später ausgeglichen werden können, besteht diese Möglichkeit für affektive und soziale Kompetenz nur in einem reduzierten Maße.4)
[Seite 40] Somit bildet die Elternbeziehung das Modell für die soziale Interaktion, an dem sich ein Kind im
späteren Leben weitgehend orientieren wird, und es liefert die Vorlage dafür, wie flexibel oder
rigide Beziehungen außerhalb der Familie gestaltet werden.
Somit bildet die Elternbeziehung das Modell für die soziale Interaktion, an dem sich ein Kind im
späteren Leben weitgehend orientieren wird, und es liefert die Vorlage dafür, wie flexibel oder
rigide Beziehungen außerhalb der Familie gestaltet werden.
Die drei Kompetenzfelder Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeit sowie sozial-emotionale Fähigkeiten können jedoch nicht im luftleeren Raum bewertet werden, da ihre Wirksamkeit mit der Authentizität ihres Einsatzes in engem Zusammenhang steht. Die Stärke der Authentizität entstammt dem Bewusstsein eines Menschen. Mit anderen Worten: Das neue „Bühnenbild“, das den Hintergrund für einen Qualitätssprung im System Familie bildet, ist ein neues Bewusstsein der Beteiligten, das Bewusstsein der Gleichwertigkeit der Geschlechter und das Wissen um die geistige Dimension des Menschen.
NEUES BEWUSSTSEIN: GLEICHWERTIGKEIT DER GESCHLECHTER
Das Verständnis der Natur des Menschen, wie es uns aus den Weisheitslehren der Welt entgegentritt, entwirft das Bild eines Wesens, dem Würde und geistiger Adel zutiefst zu eigen sind: „O Sohn des Geistes! Edel erschuf Ich dich, du aber hast dich selbst erniedrigt. So erhebe dich zu dem, wozu du erschaffen wurdest!”5) Das Wissen darum, dass der Mensch - jeder Mensch - neben seiner körperlichen und psychischen auch eine spirituelle Dimension hat, bewirkt, dass es uns leichter fällt, dem Partner/der Partnerin Achtung für sein/ihr So-Sein entgegen zu bringen und die eigene Person ebenso respektvoll zu behandeln.
Mit dem Wissen um die spirituelle Dimension erschließt sich auch ein individueller Lebenssinn, der es uns erlaubt, die Herausforderungen und Probleme des Lebens in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen. Das wiederum findet seinen Niederschlag in einem Faktor, den eine Studie der University of California in Berkeley als grundlegend im Zusammenhang mit dauerhaftem Eheglück analysiert hat: das optimistische Naturell.
Das Prinzip der Gleichwertigkeit der Geschlechter hat die Beziehungen von Menschen untereinander revolutioniert - und tut es noch! Nach wie vor sind Regierungen und Kommunen damit beschäftigt, auf rein formaler Ebene die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Gleichwertigkeit im Arbeitsumfeld zur äußeren Realität wird. Kaum berührt davon sind jedoch die inneren Prozesse der Transformation, die Gleichwertigkeit zu einer inneren Realität im Bewusstsein der Menschen werden lässt, um der nun anstehenden Qualitätsveränderung innerhalb der zwischenmenschlichen Beziehungen gerecht zu werden.
NEUE PRIORITÄT: GESUNDE BEZIEHUNGEN
Immer mehr Menschen erteilen einer Priorität der Ökonomie eine Absage. Stattdessen wird die Bedeutung gesunder Beziehungen immer mehr erkannt.
Dabei sind wiederum Beziehungsqualität und körperlich-seelische Gesundheit zwei Parameter, die eng miteinander verwoben sind: Neben den Arbeitsbedingungen eines Menschen ist die Qualität seines Beziehungsumfeldes jener Faktor, der maßgeblich mitbestimmt, ob aus einer Disposition eine Krankheit wird. So liefert uns die körperliche Symptomatik wichtige Anhaltspunkte für eine Beschäftigung mit Themen, die auf der Beziehungsebene einer Klärung bedürfen.
Das soziale Wesen Mensch benötigt eine gute Qualität auf sämtlichen Beziehungsebenen: in der Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen, innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Familie und Ursprungsfamilie, innerhalb von Arbeitsbeziehungen und auch - was oft ausgeklammert wird - in Beziehung zur Schöpfungsmacht.
[Seite 41] Vier dieser Beziehungsebenen betreffen das Thema Familie direkt:
Vier dieser Beziehungsebenen betreffen das Thema Familie direkt:
POTENZIALE DER FAMILIE
ERSCHLOSSENES POTENZIAL ICH IN BEZIEHUNG ZU MIR
- Gesunde Selbstliebe und -akzeptanz
- Freiheit von „Altlasten“
- Bilanz ziehen eröffnet neue Wege
PARTNERSCHAFT
- Die Persönlichkeit hinter der „Rolle“ des Partners/der Partnerin wahrnehmen
- Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz
- Gemeinsame Werte, geteilte Vision
- Freiheit von „Altlasten“
- Miteinander beraten können
Familie
- Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz
- Beachtung von systemischen Ordnungsprinzipien
- Grenzverletzungen vorbeugen
- Lernatmosphäre
ICH IN BEZIEHUNG ZUR SCHÖPFUNGSMACHT
- Bewusstsein über: Was möchte ich geben?
- Bewusstsein über den persönlichen Lebenssinn
Wollen wir die Qualität unseres eigenen familiären Gefüges analysieren und jene Entwicklungsfelder
definieren, die Potenziale bergen, die darauf warten, erschlossen und weiter ausgebaut zu werden,
ist es wichtig klarzustellen, dass das spezifische Wissen, die notwendigen Fähigkeiten und das
Bewusstsein, das gesunden Beziehungen zugrunde liegt, erlernbar sind!
Wenn wir uns dafür entscheiden, unerschrocken die Herausforderungen anzunehmen, vor die uns die zunehmende Komplexität und Vernetztheit der bestimmenden Faktoren im System Familie stellen, werden wir eine neue Dimension der Beziehungsqualität erreichen und damit jenes Potenzial erschließen, das heute noch weitgehend im Verborgenen wartet!
- Text und Fotos:
- Daniela und Walter E. Fritzsche
QUELLENANGABEN
- 1) UREINWOHNERIN DER ARKTISREGION NUNAVUT, IN: GEO WISSEN, FAMILIE, 2004
- 2) LANSFORD, ABBEY & STEWART, JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 63, 2001
- 3) BOYUM & PARKE, 1995
- 4) WEINFIELD, SROUFE & EGELAND, 2000
- 5) BAHÁ’U’LLÁH, VERBORGENE WORTE ARABISCH NR. 22
- Ein Bündnis und eine Familie sind wie
- ein Steinhaufen: Du nimmst einen
- einzigen Stein heraus, und das Ganze
- bricht auseinander.
- Quelle: Midrasch Raba zu 1. Mose 100
Keuschheit ... oder die Wiederentdeckung eines Wortes[Bearbeiten]
Eine Anekdote erzählt, ein Bischof sei einmal leicht verwirrt zum Abendgottesdienst erschienen. Das konnte nur geschehen, weil das Medikament, das ihm an diesem Tag verordnet worden war, sich nicht mit dem Gläschen Wein vertrug, das er zum Abendessen zu trinken pflegte. Seine Mitarbeiter bemerkten das Malheur erst, als es zu spät war und er bereits die Kanzel erklommen hatte. Von dort herab redete er konfuses Zeug, bis es einem seiner Assistenten endlich gelang, ihn sanft vom Mikrofon wegzuführen. Das letzte, was er von sich gab, war: „Aber die schlimmste Sünde ist die Unkeuschheit.“ Das ist das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Ein Umfeld, in dem es das Wort Keuschheit nur in der Verneinung gab, als „Unkeuschheit”. Und keiner von uns Kindern und Jugendlichen wusste so genau, um was es da eigentlich ging. Als wir es schließlich erfuhren, war es für jeden wahrscheinlich etwas anderes. Wir haben ja nie darüber gesprochen. Aber wir wussten, wir hatten etwas Schlimmes getan und es machte uns unglücklich.
Man hat uns immer vorgehalten, wie schlimm Unkeuschheit sei. Aber man hat uns nie gesagt, wie schön Keuschheit sein kann. Dies ist meine Geschichte ihrer Entdeckung. Sie begann, als ich in der Bibel auf einen Text stieß, den man in keinem Gottesdienst zu hören bekommt.
- Wie schön bist du, herrlich und lieb,
- mein Leben, meine Wonne!
- Dein Wuchs gleicht einer Palme, deine Brüste
- sind prall wie die Trauben der Datteln,
- Sehnsucht ergreift mich, die Palme zu
- ersteigen, zu greifen die Brüste,
- zu kosten am Busen den köstlichen Wein.1)
Ein erotisches Gedicht in der Bibel? Was hat das in einem Buch verloren, das wir Wort Gottes
unter den Menschen nennen? Bei der Suche nach einer Antwort fand ich zwei Wörter, die
Zwillingsschwestern sein könnten, so eng gehören sie zusammen: Schönheit und Keuschheit.
- „Von Schönheit sprechen wir, wenn wir etwas als das genießen, was es ist, unabhängig davon, ob wir es besitzen.“
- (Umberto Eco)
Und Keuschheit ist das Wissen, dass man einen Menschen niemals besitzen kann. Das muss
erläutert werden.
Die Schönheit erfreut den Blick und den Geist. Was schön ist bringt Freude. Schön ist all das, was uns gefällt, was Bewunderung erregt und den Blick auf sich zieht. Schönheit zeigt sich in der Harmonie des Kosmos, in der Dichtung, in der Bezauberung, die Menschen jubeln lässt. Die Schönheit eines lebendigen Körpers drückt die Harmonie von Seele und Leib aus. Schön ist das Interessante, das Angenehme, das Liebenswerte, das Ersehnte, das Reizvolle. In der höchsten Steigerungsform ist es das Wesen der Seele.
Das Licht, das von den Dingen ausgeht, ist ein Widerstrahl des einen Lichtes, das Gott ist. Das rührt offensichtlich daher, dass der Geist von jenem göttlichen Glanz erfasst wird, der sich in einem Menschen wie in einem Spiegel bricht. Schönheit wird somit umso strahlender, je näher sie der göttlichen Schönheit ist.
- Jerusalem
Ist Schönheit einer der Namen Gottes? Wenn das so ist, dann sollten wir Texte aus dem Hohen Lied
noch einmal und mit anderen Augen lesen. Aus
[Seite 43] einem Blickwinkel, der uns ahnen lässt, dass wir uns in der Schönheit Gott nähern. Was immer das
heißen mag.
einem Blickwinkel, der uns ahnen lässt, dass wir uns in der Schönheit Gott nähern. Was immer das
heißen mag.
- Still! Ihr Töchter der Stadt, ich beschwöre euch,
- bei den leisen Füßen der Gazellen,
- still, und stört nicht die Liebe - bis sie von
- selber erwacht!
- Du hast mich verzaubert - meine Freundin,
- mit einem einzigen Blick und mit einem
- kleinen Ring aus deinem Schmuck.
- Wie wohl tut mir deine Liebe,
- mehr als der köstlichste Wein.
- Meine Freundin, wie duftet dein Leib,
- besser als Narde und Ambra.
- Honig sammle ich von deinen Lippen!
- Milch trinke ich aus deinem Munde,
- und von deinem Hemde strömt ein Duft
- wie aus dem Wald des hohen Libanon.
Der Freund ruft nach der Freundin:
- Wach auf, meine Freundin, mach mir auf,
- meine Taube, meine Schwester ohne Tadel!
- Ich friere und bin nass vom Tau der Nacht.
Die Freundin in der Kammer:
- Aber ich habe den Rock schon ausgezogen,
- muss ich mich wieder anziehen?
- Da: mein Freund - streckt die Hand durchs Riegelloch!
- Alles in mir erzittert - ich weiß nicht - was soll ich tun?
- Ich stehe doch auf, dem Freund zu öffnen -
- doch am Riegel gleitet die Hand aus -
- endlich bringe ich die Tür auf - da ist mein
- Freund fort -
- Entschwunden.
- Himmlisches Jerusalem
- Tempelmotiv
- Ich suche ihn, doch kann ich ihn nicht finden
- - ich rufe ihn - doch bleibe ich ohne Antwort.
- Aber die Wächter hören mich,
- die in der Stadt umgehen.
- Sie schlagen mich wund, sie reißen den Schleier
- von meinen Schultern.
- Ihr Töchter der Stadt, ich beschwöre euch:
- Seht ihr meinen Freund, so saget ihm:
- Ich bin krank - so krank vor Liebe. 2)
Die Liebe, die Sehnsucht, das Verlangen nach Schönheit - ein Bild für die urewige Sehnsucht
des Menschen nach Gott. Kann man diese Sehnsucht der Seele schöner beschreiben als in diesen
Texten? Wundgeschlagen eilt das Mädchen durch die dunkle Stadt in vergeblicher Suche und ist
krank vor Liebe. So endet dieses Gedicht, das uns mehr über Gott sagt und über uns, als es
im ersten Augenblick scheint. Es endet mit einem vor Sehnsucht kranken Menschen.
Bahá’u’lláh, der Stifter der Bahá’í-Religion und ein großer Mystiker, schreibt in seinem Buch „Die Sieben Täler“ die Fortsetzung dieses Hohen Liedes:
- Schließlich trieb der Baum seiner Sehnsucht die Frucht der Verzweiflung, und das Feuer seiner Hoffnung erstarb in der Asche, so dass er eines Abends lebensmüde sein Haus verließ und die Straße hinauszog. Plötzlich gewahrte er, wie ihn eine Nachtwache verfolgte. Er versuchte zu fliehen, doch die Wache eilte ihm nach, und es wurden ihrer viele, so dass ihm am Ende jeder Ausweg verstellt war. Gehetzt schrie er auf, lief ohne Ziel hin und her.
- So kam dieser weidwunde Liebende mit Füßen, die liefen, und einem Herzen, das ächzte, bis an die Mauer eines Gartens, die er mit größter Mühe erklomm. Aber oben angelangt, erkannte er ihre schwindelnde Höhe und stürzte sich, sein Leben nicht achtend, hinab in den Garten.
- Doch siehe, welch ein Anblick! Dort war seine Geliebte, eine Lampe in der Hand, einen Ring suchend, den sie verloren hatte. Und als er, der sein Herz verloren, sie, die es ihm geraubt hatte, ansah, entrang sich ihm ein Seufzer der Erlösung. 3)
Was für eine Geschichte! Von unfassbarer Sehnsucht, von unbegreiflicher Liebe, von
verzweifelter Suche und der Erlösung im völligen Aufgeben des eigenen Lebens. Gott zu finden in
der Schönheit. Ich bekenne freimütig, dass es vor allem die weibliche Schönheit ist, die mich als
Mann bei der Suche bis ins Innerste bewegt. Das wird man verstehen. Und als Mann frage ich mich
aber auch, wie viel hat Sehnsucht mit Begehren zu tun? Aber war nicht gerade Schönheit definiert
worden als unabhängig von Begehren? Hier tritt die Zwillingsschwester der Schönheit auf, die
Keuschheit. In den Worten eines Dichters ausgedrückt:
- Eros statt Sex: Sehen statt greifen; fühlen statt wissen; empfinden statt kennen; loslassen statt halten; Vertrauen statt Schamlosigkeit; erinnern statt haben. (W. Schnurre)
Sehen statt greifen - ein Mensch ist ein so großes, ein so staunenswertes Wunder, einen Menschen kann ich nur mit Ehrfurcht ansehen. Das Gegenteil davon wäre Grabschen.
Fühlen statt wissen — auch wenn ich dich liebe, auch wenn ich dich kenne, weiß ich doch nicht, wer du bist. Du bleibst für mich ein Geheimnis, dem ich mich nur fühlend nähern kann. Das Gegenteil davon wäre Beherrschen.
Empfinden statt kennen - einen Menschen zu kennen, hieße, sich ein Bild von ihm gemacht zu haben, ihn in eine Schublade zu stecken, mit ihm fertig zu sein. Dabei kann ich allenfalls ahnen, wer du bist. Das Gegenteil davon wäre Besitzen.
Vertrauen statt Schamlosigkeit - wir vertrauen einander, wir brauchen uns nicht zu entblößen bis zur Schamlosigkeit, um einander nahe zu sein. Ich darf meinen letzten Schleier vor dir behalten, wenn ich es mag und du auch. Das Gegenteil davon wäre Pornografie.
Erinnern statt haben — lasst uns nie fertig damit sein, uns von der Liebe zu erzählen und lass mich nie damit aufhören, um dich zu werben. Das Gegenteil davon wäre Tod.
Eros statt Sex — das ist Keuschheit. Keuschheit hat sehr viel mehr mit Erotik zu tun, als manche Sittenwächter sich vorstellen können. Wir müssen uns davor hüten, in die Unkeuschheitsfalle zu tappen, die sie aufgestellt haben. Wir müssen uns hüten, in der Keuschheit etwas Negatives zu sehen, ein Verbot, eine Beschneidung der Lebensfreude. Keuschheit hat nichts mit Verbiegen oder Verdrängung zu tun, aber viel mit Veredeln. Im Wörterbuch der deutschen Sprache von Jacob und Wilhelm Grimm lesen wir:
„keusch: der älteste begriff aber scheint rein. ... die bedeutung, welche der reichen entwicklung des gebrauches von rein überall zu grunde liegt, ist "frei von fremdartigem, das entweder auf der oberfläche haftet oder dem stoffe beigemischt ist, die eigenart trübend”“
Das finde ich hoch interessant. Wenn keusch rein bedeutet und rein frei sein heißt von allem, was die Eigenart trübt, dann heißt keusch sein, unserem Wesen nach zu leben, ungetrübt, aufrecht, gerade. Keusch heißt also zu sein, wie wir sein sollen als Mensch, so, wie es uns glücklich macht und wie es uns ganz und gar erfüllt.
Es kam mir vor, als würde die Welt auf den Kopf gestellt und alles, was vorher falsch war, mit einem mal richtig. Die Worte von Bahá’u’lláh über die Keuschheit bekommen einen ganz neuen, tieferen Sinn. Wieder sind wir gefragt, mit neuen Augen zu sehen:
- Ihr seid erschaffen, einander Liebe zu bezeigen, nicht Eigensinn und Groll. Seid nicht stolz auf eure Eigenliebe, sondern auf die Liebe zu euren
- Versunkene Stadt
- Florentinische Nacht
- Mitgeschöpfen. Rühmt euch nicht der Liebe zu eurem Vaterland, sondern der Liebe zur ganzen Menschheit. Lasst euer Auge keusch, eure Hand getreu, eure Zunge wahr und euer Herz licht sein. 4)
Das ist das Bild vom Menschen, wie er sein kann. Schön und gut, durchgeistigt und edel. Mit viel Liebe zu allen Geschöpfen, treu, wahr, mit einem Licht erfüllten Herzen und einem keuschen Auge, das die Menschen mit Ehrfurcht betrachtet. Denn in jedem Menschen lebt das Bild Gottes.
- Verhüllt in Meinem unvordenklichen Sein und in der Urewigkeit Meines Wesens, wusste Ich um Meine Liebe zu dir. Darum erschuf ich dich, prägte dir Mein Ebenbild ein und offenbarte dir Meine Schönheit.5)
Und so schließt sich der Kreis. Die Keuschheit wendet sich wieder der Schönheit zu. Zusammen sind sie die Quelle einer veredelten Erotik. Die Mystiker wussten von alters her um deren große Bedeutung.
- Der wahrhafte Sucher verfolgt nichts als den Gegenstand seines Verlangens, und der Liebende hat kein Ziel als die Vereinigung mit dem Geliebten. Doch wird der Sucher nur dann sein Ziel erreichen, wenn er allen Dingen entsagt: er muss alles, was er gesehen, gehört und verstanden hat, in den Wind schlagen können, um in das Reich des Geistes zu kommen, das die Stadt Gottes ist. 6)
Oder profaner, aber auch nicht weniger schön von Umberto Eco
- Wenn ich dich vorbeigehen sehe
- in solch königlicher Distanz
- das Haar gelöst
- und die ganze Erscheinung wie eine Lanze
- reißt mich der Schwindel dahin.
Und so werde ich künftig auf die Frage meiner Frau, ob denn sich von allem loszulösen außer Gott und das Herz ungeteilt ihm zuzuwenden, heiße, auch unsere Liebe aufzugeben, antworten, nein, denn sie ist doch der Weg dorthin.
- Thomas Schaaff
QUELLENANGABEN
- 1) DAS HOHE LIED 7,7-10
- 2) DAS HOHE LIED 2,7; 4,9-11; 5,2-8
- 31) DIE SIEBEN TÄLER, S.24
- 4) BOTSCHAFTEN AUS AKKA 9:5
- 5) VERBORGENE WORTE, ARABISCH 3
- 6) DIE SIEBEN TÄLER, S.19
- Orientalische Stadt
- DIE BILDER ENTSTAMMEN DER SERIE
- „ARCHITEKTONISCHE MOTIVE" DES KÜNSTLERS
- HENNING HAUKE, AUS ZELL U.A./ PLIENSBACH.
- DIE FARBIGEN MOTIVE KÖNNEN HIER
- NUR IN GRAUSTUFEN DARGESTELLT WERDEN.
- AUF WWW.H-HAUKE.DE SIND WEITERE,
- AKTUELLERE WERKE DES KÜNSTLERS ZU SEHEN.
Familie der Zukunft - Zukunft der Familie[Bearbeiten]
Familie im Spannungsfeld zwischen Tradition und Gleichberechtigung
In den vergangenen 50 Jahren hat sich das Bild von Ehe und Familie in der westlichen Welt grundlegend geändert. In Deutschland wie auch in vielen anderen westlichen Ländern erleben wir einen Trend hin zu längerer Lebenserwartung, späterer Eheschließung, mehr unverheiratetem Zusammenleben, weniger Kindern, mehr Scheidungen, mehr allein erziehenden Eltern und „Patchwork-Familien“, mehr arbeitenden Müttern, größerem Bedarf an Kinderbetreuung und weniger Familienbeziehungen durch wachsende Mobilität und veränderte berufliche Anforderungen.1)
Beim Erstheiratsalter ist in Deutschland ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Während im Jahre 1991 Frauen durchschnittlich mit 26,1 und Männer mit 28,5 Jahren das erste Mal heirateten, taten sie das 2001 mit 28,8 und 31,6 Jahren.2) Das Alter der Erstgebärenden steigt ebenfalls stetig und lag 2001 in Deutschland bei 29,7 Jahren und die Geburtenrate, die in Ost- und Westdeutschland inzwischen fast identisch ist, betrug 1,3, verglichen mit 2,2 im Jahr 1950.3) Somit gehört Deutschland zu den Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten der Welt.
Dieser Rückgang in den Geburtenraten lässt allerdings nur bedingt Rückschlüsse auf die nachlassende Bedeutung zu, die Kindern im Leben eingeräumt wird, denn er spiegelt hauptsächlich die Reduzierung der durchschnittlichen Familienkinderzahl wider. Ein Grund für den Rückgang in der Anzahl der Kinder pro Familie könnte neben der Veränderung der Bedeutung der Familie darin liegen, dass viele Personen (besonders Frauen) der Überzeugung sind, dass weitere wichtige Lebensziele wie Beruf, Wohlstand und Selbstverwirklichung mit wachsender Kinderzahl an Realisierbarkeit verlieren. Für viele Paare stellt sich die Frage, wie sich ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit der Gründung einer Familie vereinbaren lässt.
Diese vielfältigen Veränderungen lassen immer häufiger die Frage aufkommen, wie ein Familienmodell der Zukunft aussehen sollte. Das alte mit seinen starren Rollenzuschreibungen scheint ausgedient zu haben, aber wie könnte eine Alternative aussehen? Ist die Vorstellung von einer Familie mit Vater-Mutter-Kind(ern) überholt? Sollte man sein Leben lieber mit verschiedenen „Lebensabschnittspartnern“ verbringen und die Geburt eines Kindes weniger von einer stabilen Ehe als dem subjektiv empfundenen richtigen Zeitpunkt abhängig machen? Wenn Männer und Frauen gleiche Rechte fordern, wer kümmert sich dann um die Kinder? Wofür entscheide ich mich - Kind oder Karriere? Das sind nur einige Probleme, denen sich der moderne Mensch stellen muss.
Wenn man nun die vielen religiösen Schriften zum Thema Familie betrachtet, lohnt es sich, der Frage nachzugehen, welchen Einfluss die Religion auf das Familienkonzept ausübt und ob sie uns einen Ausweg aus diesem Dilemma zeigen kann.
DER EINFLUSS VON RELIGION UND RELIGIOSITÄT AUF DIE FAMILIE
Psychologische Studien konnten den Zusammenhang zwischen Religiosität und Ehezufriedenheit
bestätigen, und zwar einen positiven, andererseits gehen verheiratete häufiger zur Kirche,
nehmen an kirchlichen Aktivitäten teil und empfinden eine größere Nähe zu Gott.4)
Personen, die einer religiösen
[Seite 47] Konfession angehören oder für die Religion eine wichtige Rolle im Leben spielt, sind außerdem
deutlich häufiger verheiratet und haben Kinder als Nicht-Religiöse, die häufiger in unehelichen
Lebensgemeinschaften zusammenleben.5)
Konfession angehören oder für die Religion eine wichtige Rolle im Leben spielt, sind außerdem
deutlich häufiger verheiratet und haben Kinder als Nicht-Religiöse, die häufiger in unehelichen
Lebensgemeinschaften zusammenleben.5)
Obwohl immer häufiger die Ehe als Grundlage der Familie in Frage gestellt wird, zeigt die psychologische Forschung doch, dass verheiratete Menschen am glücklichsten sind und die längste Lebenserwartung haben.6) Somit scheint trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen die Ehe eine nicht zu unterschätzende Größe im Leben zu sein, und die religiöse Orientierung wiederum scheint die Ehe zu stärken.
Religion hat einen indirekten Einfluss auf die Anzahl der Kinder, welche eine Frau gebiert, besonders in Hinblick darauf, dass sie ihre Entscheidung zu heiraten und die Stabilität der Ehe beeinflusst. Heutzutage ist es immer noch wahrscheinlicher, dass eine verheiratete Frau Kinder bekommt als eine unverheiratete, selbst wenn diese in einer stabilen Partnerschaft lebt; und Ehen zwischen religiös aktiven Personen laufen seltener Gefahr, geschieden zu werden als Ehen zwischen unreligiösen Personen.7)
In einer Studie wurden 10.847 Frauen zum indirekten Einfluss der Religion auf die Ehestabilität untersucht.8) Die Ergebnisse zeigten, dass eine Scheidung wahrscheinlicher ist, wenn ein oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen (in Reihenfolge ihrer Bedeutung):
- Vorehelicher Geschlechtsverkehr
- Unfreiwilliger erster Geschlechtsverkehr, zum Beispiel bei Missbrauch oder Vergewaltigung
- Geburt eines Kindes vor der Ehe
- Zusammenleben vor der Ehe
Alle diese Faktoren hängen indirekt mit der religiösen Orientierung der untersuchten Personen zusammen, da die sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe eng mit der Stärke der religiösen Lebensführung zusammenhängt.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass Religiosität sich förderlich auf die Lebensqualität und die Zufriedenheit in der Ehe auswirkt, zu einem gewissen Grad scheidungspräventiv wirkt und die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, erhöht.
Offen ist jedoch noch die Frage, wie eine Familie der Zukunft aussehen könnte. Welche Rollen können Mann und Frau innerhalb der Familie übernehmen, wie müssen sich diese von traditionellen Geschlechterrollen unterscheiden, um für die Zukunft tragbar zu sein?
Wie in verschiedenen Studien9) festgestellt wurde, unterscheiden sich die Geschlechterrollenorientierungen der Befragten je nach ihrer Religionszugehörigkeit und zwar dahingehend, dass eine starke christliche Orientierung und ein starkes religiöses Engagement innerhalb einer christlichen Kirche allgemein einen konservativen Einfluss auszuüben scheinen. Dadurch entsteht das Dilemma, dass (christliche) Religiosität zwar die Familie stärkt, andererseits aber die traditionellen Rollenvorstellungen verstärkt, von denen der moderne Mensch sich zu lösen versucht.
Ein alternatives Familienkonzept können wir in der Bahá’í-Religion finden, wo die Gleichberechtigung der Geschlechter eines der grundlegenden Prinzipien ist:
- „Die Menschheit gleicht einem Vogel mit seinen zwei Schwingen: die eine ist das männliche, die andere das weibliche Geschlecht. Sofern nicht beide Schwingen stark sind und durch eine gemeinsame Kraft bewegt werden, kann sich der Vogel nicht himmelwärts schwingen.“10)
Der Erziehung und Ausbildung von Mädchen und Frauen wird in der Bahá’í-Gemeinde außerordentlich
große Bedeutung zugemessen.11) Eine Studie, welche den Einfluss dieser religiösen Lehren
zur Gleichberechtigung belegt, ist eine Untersuchung von Feather et al. (1992). Diese stellte fest,
dass sich männliche iranische Bahá’í in ihrer Geschlechterrolleneinstellung stark von den in ihrer
männerdominierten Kultur üblichen Werthaltungen unterschieden und dass sie eine deutlich
egalitärere Einstellung zeigten.
Somit scheint das Bahá’í-Familienkonzept beide Elemente in sich zu vereinen - ein eher traditionelles Familienbild, in dem die Eltern (möglichst auf Lebenszeit) verheiratet sind und die Ehe auf die Erziehung von Kindern ausgerichtet ist, sowie eine Geschlechterrollenorientierung, welche die Gleichberechtigung anstrebt.
Um diese Annahme empirisch zu überprüfen, führte ich 2002/2003 eine Untersuchung durch,
die 346
[Seite 48] christliche und Bahá’í-Studenten über ihre Einstellung zu Familienleben und Geschlechterrollen
befragte.
christliche und Bahá’í-Studenten über ihre Einstellung zu Familienleben und Geschlechterrollen
befragte.
ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
Bahá’í und Christen unterscheiden sich in Bezug auf ihre familienbezogenen Einstellungen voneinander, wobei die Bahá’í-Stichprobe eine stärkere Familienorientierung aufweist (siehe Abbildung 1), beide Gruppen messen jedoch der Familie eine hohe Bedeutung bei.
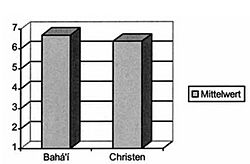
Zwischen Bahá’í und Christen gibt es keine Unterschiede hinsichtlich des Wunschzeitpunktes
für die Geburt des ersten Kindes - dieser liegt bei 27,7 Jahren und somit zwei Jahre unter
dem durchschnittlichen Alter von Erstgebärenden, welches 29,7 Jahre beträgt - aber in Bezug
auf das Heiratsalter liegen die Bahá’í durchschnittlich 1,4 Jahre unter den Christen.
Während die Bahá’í-Gruppe ein Alter von 25,2 Jahren als bestes Heiratsalter ansieht, empfinden die Christen 26,7 Jahre als optimal. Somit liegen beide Gruppen wiederum deutlich unter dem durchschnittlichen Heiratsalter in Deutschland von 29,6 Jahren. Daraus könnte man schlussfolgern, dass junge Erwachsene heutzutage durchaus gerne früher heiraten würden, sich aber vermutlich aus Praktikabilitätsgründen dagegen entscheiden oder sich nicht in der Lage sehen, ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. Daraus folgt natürlich auch häufig eine geringere Kinderzahl, denn je später das erste Kind geboren wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für die Geburt weiterer Kinder.
Für die Christen ist die Geburt von Kindern weniger wichtig als für Bahá’í. Und während sich 98,8 Prozent der Baha’l ein Leben ohne Ehe nicht vorstellen können, ist das für einen Teil der Christen durchaus eine Option. Das wird dadurch bestätigt, dass 9,6 Prozent nach eigenen Angaben unehelich mit einem Partner zusammen leben, während kein Bahá’í diese Lebensform praktiziert. Das untermauert die Annahme, dass die Bahá’í stärker als die Christen ein eher traditionelles Familienbild vertreten, bestehend aus einem Mann und einer Frau, die legal verheiratet und auf die Erziehung von Kindern ausgerichtet sind. Ein weiteres Merkmal des traditionelleren Familienbildes der Bahá’í ist, dass bei ihnen die Religion deutlich wichtiger für das Familien- und Eheleben ist als für die befragten Christen (siehe Abbildung 2).
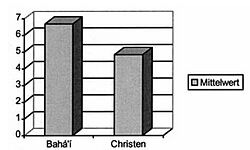
Da die Bahá’í in meiner Untersuchung deutlich religiöser sind als die Christen (Mittelwert der
Bahá’í: 5,87, Mittelwert der Christen: 3,90 bei einer Skala von 1 bis 7), bestätigt dieses
Ergebnis den erwähnten Zusammenhang zwischen Religiosität, Heiratsneigung und der
Wahrscheinlichkeit, Kinder zu haben.12)
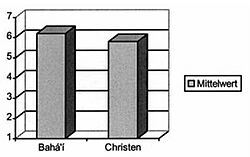
Besonders interessant ist dieses Ergebnis im Hinblick auf die Geschlechterrollenorientierung.
Hier weisen die Bahá’í tatsächlich eine egalitärere Einstellung auf als die Christen (6,2
gegenüber 5,8 bei einem Maximalwert von 7, siehe Abbildung 3), was auf eine starke Verinnerlichung
des Prinzips der Gleichberechtigung und einen bewussteren Umgang mit diesem Thema hin deutet.
Somit zeigen
[Seite 49] die Bahá’í ein ungewöhnliches Muster von Einstellungen, welches sich aus einer egalitären Geschlechterrollenorientierung und einem eher traditionellen Familienbild zusammensetzt. Es zeigt
sich also ein interessanter Effekt: Sowohl bei den Christen als auch den Bahá’í beeinflusst die
Religiosität die Familienorientierung positiv (bei den Bahá’í noch etwas stärker als bei den
Christen), die Rollenvorstellungen werden jedoch von den beiden religiösen Orientierungen
gegensätzlich beeinflusst. Während bei den Christen die Religiosität die traditionellen
Rollenvorstellungen verstärkt, wirkt sie sich bei den Bahá’í dahingehend aus, dass sie eine
mehr gleichberechtigte Einstellung fördert.
die Bahá’í ein ungewöhnliches Muster von Einstellungen, welches sich aus einer egalitären Geschlechterrollenorientierung und einem eher traditionellen Familienbild zusammensetzt. Es zeigt
sich also ein interessanter Effekt: Sowohl bei den Christen als auch den Bahá’í beeinflusst die
Religiosität die Familienorientierung positiv (bei den Bahá’í noch etwas stärker als bei den
Christen), die Rollenvorstellungen werden jedoch von den beiden religiösen Orientierungen
gegensätzlich beeinflusst. Während bei den Christen die Religiosität die traditionellen
Rollenvorstellungen verstärkt, wirkt sie sich bei den Bahá’í dahingehend aus, dass sie eine
mehr gleichberechtigte Einstellung fördert.
Möglicherweise könnte die Kombination aus starker traditioneller Familienorientierung und gleichberechtigten Geschlechterrollen ein Familienmodell sein, welches den Bedürfnissen und Anforderungen der modernen Welt gerecht werden kann, da es sowohl den jedem Menschen inne wohnenden Wunsch nach Geborgenheit und Stabilität in der Familie erfüllt als auch den im Laufe der Geschichte veränderten Rollenbildern Rechnung trägt. Wie dieses Familienmodell in der Praxis aussehen kann, wird natürlich erst die Erfahrung vieler Familien zeigen, wodurch uns allen die spannende Aufgabe zukommt, ein mögliches Familienmodell der Zukunft mit zu gestalten.
QUELLENANGABEN
- 1) HIEBERT, W. (2002). THE CHANGING SHAPE OF MARRIAGE - AMERICAN STYLE. ILLINOIS COUNCIL OF FAMILY RELATIONS NEWSLETTER, 3, 3-4
- 2) STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN (2002). DATENREPORT 2002. ZAHLEN UND FAKTEN ÜBER DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. BONN: BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG
- 3) A.A.O.
- 4) Z.B. GURIN, G., VEROFF, J. & FELD, S. (1960). AMERICANS VIEW THEIR MENTAL HEALTH: A NATION WIDE INTERVIEW SURVEY. OXFORD: BASIC BOOKS.; POLOMA, M.M. & PENDLETON, B.E. (1991). EXPLORING NEGLECTED DIMENSIONS OF RELIGION IN QUALITY OF LIFE RESEARCH. LEWISTON: THE EDWIN MELLEN PRESS
- 5) DORBRITZ, J. & Fux, B. (1997). EINSTELLUNGEN ZUR FAMILIENPOLITIK IN EUROPA. ERGEBNISSE EINES VERGLEICHENDEN SURVEYS IN DEN LÄNDERN DES „EUROPEAN COMPARATIVE SURVEY ON POPULATION POLICY ACCEPTANCE (PPA)". MÜNCHEN: BOLDT IM OLDENBOURG-VERLAG
- 6) Z.B. SCHNEEWIND, K. (1994). ERZIEHUNG UND SOZIALISATION IN DER FAMILIE. IN K. SCHNEEWIND (HRSG,), PSYCHOLOGIE DER ERZIEHUNG UND SOZIALISATION (S. 436-464). GÖTTINGEN: HOGREFE
- 7) BÉLANGER, A. & QUELLET, G. (2002). A COMPARATIVE STUDY OF RECENT TRENDS IN CANADIAN AND AMERICAN FERTILITY, 1980-1999. IN: STATISTICS CANADA. REPORT ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN CANADA 2001. TORONTO: STATISTICS CANADA.; WITTBERG, P.(1999). FAMILIES AND RELIGION. IN M.B. SUSSMAN, S.K. STEINMETZ & G.W. PETERSON (EDS.), HANDBOOK OF MARRIAGE AND THE FAMILY (pp. 503-523). NEW YORK: PLENUM
- 8) Heaton, T.B. (2002). FACTORS CONTRIBUTING TO INCREASING MARITAL STABILITY IN THE UNITED STATES. JOURNAL OF FAMILY ISSUES, 23(3), 392-409
- 9) Z.B. VIANELLO, M., SIEMIENSKA, R., DMIAN, N., LUPRI, E., COPPI, R., D'ARCANGELO, E. & BOLASCO, S. (1990). GENDER INEQUALITY. A COMPARATIVE STUDY OF DISCRIMINATION AND PARTICIPATION. LONDON: SAGE.; GIELE, J.Z. (1988). GENDER AND SEX ROLES. IN N.J.SMELSER (ED.), HANDBOOK OF SOCIOLOGY (pp. 291-323). NEWEURY PARK: SAGE
- 10) 'ABDU'L-BAHÁ, ZITIERT IN ESSLEMONT, J.E. (1976). BAHÁ’U’LLÁH UND DAS NEUE ZEITALTER. HOFHEIM-LANGENHAIN: BAHÁ’Í, S.171
- 11) ESSLEMONT, J.E. (1976). BAHÁ’U’LLÁH UND DAS NEUE ZEITALTER. HOFHEIM-LANGENHAIN: BAHÁ’Í, S.171
- 12) VGL. DORBRITZ, J. & FUX, B. (1997). EINSTELLUNGEN ZUR FAMILIENPOLITIK IN EUROPA. ERGEBNISSE EINES VERGLEICHENDEN SURVEYS IN DEN LÄNDERN DES „EUROPEAN COMPARATIVE SURVEY ON POPULATION POLICY ACCEPTANCE (PPA)". MÜNCHEN: BOLDT IM OLDENBOURG-VERLAG
- Katrin Modabber
- Dipl. Psychologin,
- verheiratet,
- Mutter eines Sohnes
INTEGRATION
In einer zusammenwachsenden Welt findet sie unablässig statt, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Die zunehmenden Abhängigkeiten aller Teile unseres Planeten erfordern aber ein Bewusstsein, das den Herausforderungen dieses Prozesses der Globalisierung gerecht wird. Ohne ein solches Bewusstsein wird der Globus zu einem Schauplatz egoistischer Wahnideen, die in die gegenseitige Zerstörung führen, zum Kampf der Kulturen. Zusammenarbeit und Verständnis sind die entschieden besseren Alternativen.
Wir haben die Wahl: Entweder bemühen wir uns, das Andersartige, fremd Erscheinende, die Vielfalt der Kulturen und Sichtweisen als Entwicklungschance anzunehmen, oder wir werden zum Opfer unserer Ängste und zu Schöpfern unserer zukünftigen Feinde.
Die nächste Ausgabe der TEMPORA wird die Vielfalt anstehender Integrationsaufgaben und Möglichkeiten aufzuzeigen versuchen. Denn es geht nicht nur um die menschenwürdige Eingliederung sogenannter Ausländer, es geht um ein neues Verständnis für das, was der Menschheit eine gemeinsame Zukunft gibt. Dafür wird der Blick über den Tellerrand des eigenen Landes hilfreich sein.
TEMPORA
- Nr. 12 - 2005
Die Globalisierung unseres Planeten erfordert in allen Bereichen ein
gänzlich neues Denken und Handeln. TEMPORA beschäftigt sich auf
dem Hintergrund der Bahá’í—Lehren mit aktuellen Zeitfragen und möchte
durch Gedankenimpulse die Entwicklung zu einer geeinten Welt fördern.
Herausgeber
- Der Nationale Geistige Rat der Bahá’í in
- Deutschland e.V., Eppsteiner Str. 89
- 65719 Hofheim-Langenhain
Redaktion
- Roland Greis, Thomas Schaaff, Monika Schramm, Karl Türke jun., Shirin Weisser, Michael Willems
Redaktionsanschrift
- Redaktion TEMPORA
- Eppsteiner Str. 89
- D-65719 Hofheim
- Internet:
- www.tempora.org
- E—Mail:
- tempora@bahai.de
Layout
Michael Willems
Druck
Druckservice Reyhani, Darmstadt
Vertrieb und Bestellungen
- Bahá’í—Verlag
- Eppsteiner Str. 89
- D-65719 Hofheim
- Tel.: +49 (0) 61 92 / 22 92 1
- Fax: +49 (0) 61 92 / 22 93 6
- www.bahai-verlag.de
TEMPORA erscheint jährlich.
Abonnementpreis für vier Ausgaben
EUR 18,00 / Einzelpreis EUR 5,00.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder des Herausgebers wieder. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine
Haftung. Die Redaktion behält sich sinnbewahrende Kürzungen
und Änderungen der Beiträge vor. Die Zeitschrift und alle in
ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
© Bahá’í-Verlag GmbH 2005
ISSN 1433-2078
Gedruckt auf umweltschonendem Papier.
Die Bahá’í-Religion
Zentrale Lehren
- Die Einheit Gottes
- Es gibt nur einen Gott,
- mit welchem Namen
- er auch benannt oder
- umschrieben wird.
- Die Einheit der Religionen
- Alle Offenbarungsreligionen bergen den
- gleichen Kern ewiger Wahrheiten, wie
- die Liebe zu Gott und den Menschen.
- Bestimmte Gesetze jedoch, die zum
- Beispiel die Organisation der Gemeinde,
- das Sozialwesen oder die Hygiene
- betreffen, müssen sich im Zuge der
- Menschheitsentwicklung verändern.
- In großen Zyklen offenbart Gott sich
- durch seine Boten wie Krishna, Buddha,
- Moses, Christus, Mohammed und
- Bahá’u’lláh und erneuert diesen Teil
- seiner Gebote als Antrieb für den
- menschlichen Fortschritt.
- Die Einheit der Menschheit
- Die Menschheit ist eine einzige,
- große Familie mit völlig
- gleichberechtigten Mitgliedern.
- Ihren Ausdruck finden diese
- grundlegenden Lehren in Prinzipien wie:
- ▪ Selbständige Suche nach Wahrheit
- ▪ Gleichstellung von Frau und Mann
- ▪ Soziale Gerechtigkeit
- ▪ Entscheidungsfindung durch Beratung
- ▪ Abbau von Vorurteilen.
- ▪ Übereinstimmung von Religion und Wissenschaft
Zentrale Gestalten
- Báb (1819-1850), der Vorbote
- Bahá’u’lláh (1817-1892), der Stifter
- 'Abdu'l-Bahá (1844-1921), der Ausleger
- Shoghi Effendi (1897-1957), der Hüter
Die Bahá’í-Gemeinde
- organisiert sich in Gremien,
- die auf örtlicher, nationaler und
- internationaler Ebene von den
- erwachsenen Gemeindemitgliedern
- in freier, gleicher und geheimer Wahl
- ohne Kandidatur oder Wahl-
- kampagnen gewählt werden.
- Es gibt keine Priester.
- 100 Jahre
- Bahá’í-Gemeinde
- Deutschland
Die nächste Ausgabe:
INTEGRATION
TEMPORA NR. 13























